Der Bodhicaryāvatāra von Śāntideva
Übersetzung aus dem Tibetischen von Christof Spitz
für die Unterweisungen S.H. des Dalai Lama in Hamburg 2014
Mitarbeit und Übersetzung des Widmungs-Kapitels aus dem Sanskrit: Sonam Spitz
© 2022 Christof Spitz
Vorwort des Übersetzers
Das Tibetische Zentrum hat seinen Schirmherrn, S.H. den 14. Dalai Lama, vom 23. bis 26. August 2014 zum sechsten Mal nach Hamburg eingeladen. Der Dalai Lama selbst wählte als Thema den berühmten Klassiker des indischen Meisters Śāntideva (8. Jh.) als Grundlage für seine Vorträge aus. Und er teilte uns seinen Wunsch mit, dass der Text an alle Teilnehmer verteilt werden möge. Denn in der Kürze der Zeit könne er nicht das gesamte Werk erklären, sondern nur einzelne Verse und Themen herausgreifen. Die Teilnehmer sollten die Möglichkeit erhalten, die gehaltvollen Inhalte zu Hause selbst weiter zu studieren und zu verinnerlichen.
Ich hatte bereits Mitte der 1990er Jahre angefangen, Śāntidevas Bodhicaryāvatāra aus dem Tibetischen zu übersetzen, als Grundlage für Unterweisungen meines Lehrers Geshe Thubten Ngawang (1933-2003). Für die Vorträge in Hamburg 2014 habe ich diese Übersetzung fertiggestellt, damit sie dort an alle Teilnehmer kostenlos verteilt werden konnte. Die Übersetzung des Widmungskapitels hat freundlicherweise Sonam Spitz erstellt.
Ich habe den Bodhicaryāvatāra aus dem Tibetischen übersetzt. An vielen Stellen weicht das Tibetische vom Sanskrit-Original ab.1 Mein großer Dank geht an Sonam Spitz, der mir beim Abgleich des Tibetischen mit dem Sanskrit geholfen und mich damit in meinem Verständnis unterstützt hat. Es war uns nicht möglich, den gesamten Text im Detail zu vergleichen, aber an schwierigen oder unklaren Stellen hat uns der Blick in das Original unschätzbare Dienste geleistet. Auch wenn uns die Abweichungen des Tibetischen vom Sanskrit bewusst waren, folgten wir, außer an wenigen in den Fußnoten dokumentierten Stellen, dem tibetischen Text und den tibetischen Kommentaren.
Allen, die sich für Śāntidevas Text näher interessieren, empfehle ich folgende Übersetzungen aus dem Sanskrit:
-
Richard Schmidt: Eintritt in den Wandel in Erleuchtung (1923). Diese ältere Übersetzung ist in einer unvergleichlich schönen Sprache verfasst. Steinkellner hat sie an einigen Stellen inhaltlich korrigiert und das Werk daher neu übersetzt.2
-
Ernst Steinkellner: Eintritt in das Leben zur Erleuchtung (1981). Wir verdanken dem großen Indologen Steinkellner die beste deutsche Übersetzung aus dem Sanskrit.3
-
Kate Crosby and Andrew Skilton: The Bodhicaryāvatāra (1995). Diese englische Übersetzung enthält viele hilfreiche Anmerkungen. Empfehlenswert sind auch die allgemeine Einführung darin von Paul Williams und die ausführliche Einleitung der Übersetzer, die einen guten Überblick über die Herkunft des Textes und die Originalquellen enthält. Das ältere, wiederentdeckte Tunhuang-Manuskript besteht aus nur 701 Versen, die spätere Edition umfasst ca. 912 Verse ‒ diese liegt sowohl dem indischem Kommentar Prajñākaramatis als auch der tibetischen Übersetzung zugrunde.4
-
Vesna A. Wallace und B. Alan Wallace: A Guide to the Bodhisattva Way of Life (1997)5
Grundlage für meine Übersetzung ist die tibetische Edition aus dem Derge Tengyur.6 Als Kommentare dienten mir hauptsächlich ein relativ kurzer Kommentar von Kyilzur Lobsang Jinpa (1821-1891)7, vor allem für das achte und neunte Kapitel, und vertiefend der sehr ausführliche Kommentar von Minyak Kunzang Sönam (1823-1905)8. Minyaks Kommentar dokumentiert zudem viele Abweichungen der tibetischen Übersetzung vom Sanskrit. Außerdem nutzte ich den kurzen, vor allem für die Gelugpa-Schule des tibetischen Buddhismus maßgeblichen Kommentar von Gyaltsab Darma Rinchen (1364-1432)9. Sämtliche mir bekannte Kommentarliteratur Tibets und auch die Übersetzungen aus dem Sanskrit in europäische Sprachen verwenden als Hauptquelle der Interpretation den indischen Kommentar (Pañjikā) von Prajñākaramati (10. Jhdt.), der in großen Teilen noch in Sanskrit und vollständig in tibetischer Übersetzung erhalten ist.
Das zentrale Thema des Textes ist der Übungsweg eines Bodhisattvas, der aus Mitgefühl mit der Welt „mutig nach dem Erwachen (bodhi) strebt“. Obwohl für bodhi der Begriff „Erleuchtung“ verbreitet ist, enthält weder das Sanskritwort noch die tibetische Übersetzung (byang chub) eine Anlehnung an die Lichtmetapher. Vielmehr geht es um das „Erwachen“ (von der Sanskrit-Wurzel budh, „aufwachen“) aus dem „Schlaf“ der Unwissenheit.
Entsprechend habe ich auch das Wort für die zentrale Eigenschaft eines Bodhisattvas, bodhicitta, nicht wie häufig als „Erleuchtungsgeist“, sondern als „Streben nach dem Erwachen“ übersetzt.10 Das Wort bodhisattva („Mutiger, der nach dem Erwachen strebt“) und vergleichbare Begriffe wie buddhātmaja („Sohn bzw. Nachkomme des Buddhas“), die im Sanskrittext im grammatischen Maskulinum stehen, habe ich als generische Maskulina interpretiert und, soweit möglich, so übersetzt, dass sie Männer und Frauen bezeichnen. Insgesamt muss man sich bei der Lektüre jedoch bewusst sein, dass Śāntideva sich aller Wahrscheinlichkeit nach als Mönch an eine Mönchsgemeinschaft gewandt und daher den Text häufig aus der Sicht von männlichen Ordinierten verfasst hat.
An einigen wenigen Stellen wurden Anmerkungen zum Text oder zur Übersetzung in Fußnoten gemacht. Die erste Auflage von 2014 wurde für die gegenwärtige Neuauflage korrigiert und geringfügig überarbeitet .
Hamburg, im November 2022
Christof Spitz
Anleitung auf dem Weg zum Erwachen
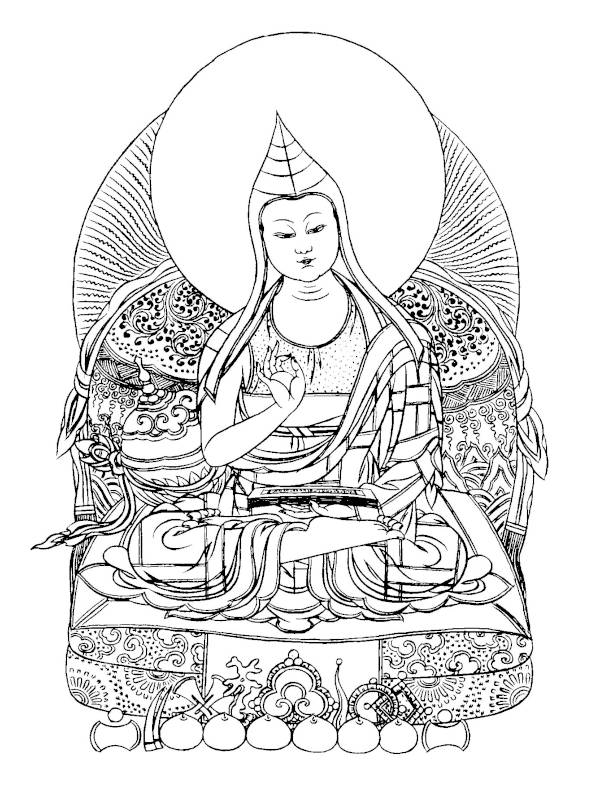
Solange der Himmelsraum besteht, und solange die Welt besteht, solange möge auch ich bestehen, um die Leiden der Wesen zu beseitigen.
(Bodhicaryāvatāra, Kapitel 10, Vers 55)
1. Die Vorzüge des Strebens nach dem Erwachen
(1) Respektvoll verneige ich mich vor den Sugatas und ihrem Körper des Dharmas (dharmakāya), vor ihren geistigen Kindern und vor allen, die der Verehrung wert sind. So will ich der Überlieferung gemäß zusammenfassend darlegen, wie man die Disziplin der Buddha-Nachkommen erlernt.
(2) Weder habe ich hier etwas zu sagen, das zuvor noch nicht gesagt wurde, noch bin ich ein Meister der Textkomposition. Daher ist es meine Absicht auch nicht, anderen zu nutzen. Allein um mich selbst mit diesen Gedanken vertraut zu machen, habe ich den Text verfasst.
(3) Denn die Kraft meines eigenen Vertrauens wird wachsen, weil ich mich mit den hierin enthaltenen Gedanken an das Heilsame gewöhne; und falls dann andere mit ähnlichen Veranlagungen das Werk betrachten, kann es auch für sie von Bedeutung sein.
(4) Diese schwer zu findende Gelegenheit, mit Freiheiten und förderlichen Umständen den Sinn des menschlichen Lebens zu verwirklichen, habe ich jetzt erlangt. Wenn ich aus dieser Lage keinen Nutzen ziehe, wie sollte sich dieses perfekte Zusammentreffen günstiger Umstände jemals wieder ergeben?
(5) Wie ein Blitz in dunkler, wolkenverhangener Nacht einen Augenblick lang alles erhellt, so mag sich durch die Kraft der Buddhas in der Welt manchmal für kurze Zeit der Verstand dem Verdienstvollen zuwenden.
(6) Das Gute ist stets schwach, das Übel jedoch mächtig und verheerend. Welche andere heilsame Kraft als der Entschluss zum vollkommenen Erwachen könnte es überwinden?
(7) Die großen Weisen, die sich über viele Zeitalter der Kontemplation hingaben, haben eben dieses Streben als nützlich erkannt. Es lässt unendlichen Scharen von Lebewesen leicht die höchste Glückseligkeit zuteil werden.
(8) Jene, die sich danach sehnen, die hundertfachen Leiden des Daseins zu überwinden, jene, die danach verlangen, das Unglück von den Wesen zu nehmen, und jene, die danach trachten, viele Hunderte Freuden zu genießen, sollen das Streben nach dem Erwachen niemals aufgeben.
(9) In dem Augenblick, in dem sie das Streben nach dem Erwachen in sich erwecken, werden die Schwachen, die im Gefängnis des Daseinskreislaufs gefesselt sind, „Kinder der Sugatas“ genannt, und sie werden verehrungswürdig in den Welten der Menschen und der Götter.
(10) Gleich dem besten Elixier, das Metall in Gold verwandelt, ergreift es dieses unreine Gebilde und verwandelt es in das unschätzbare Juwel einer Buddha-Gestalt. Greift also mit aller Kraft nach dem, was man „das Streben nach dem Erwachen“ (bodhicitta) nennt!
(11) Ihr im Dasein Umherziehenden, die ihr euch aufgemacht habt, die Marktplätze der Welt zu verlassen, greift fest nach diesem Juwel, dem Geist des Erwachens! Dessen außergewöhnliche Kostbarkeit haben eure einzigen und unermesslich klugen Karawanenführer selbst geprüft.
(12) Alles andere Heilsame gleicht der Bananenstaude: Es geht ein, wenn es seine Frucht getragen hat. Doch der immergrüne Baum des Strebens nach dem Erwachen bringt beständig Früchte hervor und wächst, ohne je zu vergehen.
(13) Warum suchen die Ängstlichen nicht Rettung in dem, wodurch sie augenblicklich auch von dem schrecklichsten Übel befreit werden, so wie man in der Obhut eines Tapferen großen Gefahren entkommt?
(14) Es verbrennt in einem Moment die immensen Übeltaten, gleich dem Feuer am Ende eines Weltzeitalters. Diese unermesslichen Vorzüge hat der weise Beschützer Maitreya den Sudhana gelehrt.
(15) Zusammenfassend soll man das Streben nach dem Erwachen als zweifach verstehen: als Streben im Sinne des Wunsches nach dem Erwachen und als Streben im Sinne des tätigen Voranschreitens zum Erwachen.
(16) Genauso wie man den Unterschied versteht zwischen dem, der nur zu reisen beabsichtigt, und dem, der unterwegs ist, sollen die Gelehrten den Unterschied zwischen diesen beiden erkennen.
(17) Schon das wünschende Streben nach dem Erwachen trägt große Früchte zur Zeit des Daseinskreislaufs. Doch daraus geht nicht der ununterbrochene Strom von Verdiensten hervor wie aus dem Streben, das mit Taten verbunden ist.
(18) Sobald einer dieses Streben mit dem unwiderruflichen Entschluss aufnimmt, die unendliche Welt der fühlenden Wesen zu befreien, (19) wachsen in ihm von da an selbst im Schlaf oder im Zustand der Achtlosigkeit unaufhörlich vielfältige Ströme von Verdiensten dem Himmel gleich an.
(20) Der Vollendete selbst hat diese Vorzüge zum Nutzen jener, die zu einem niedrigeren [Fahrzeug] neigen, in [dem Sūtra] der „Frage des Subāhu“ mit schlüssigen Begründungen gelehrt.
(21) Wenn schon einer, der die hilfsbereite Absicht hat, den Kopfschmerz der Wesen zu lindern, unermessliches Verdienst erwirbt, (22) um wie viel mehr erst jener Wohltäter, der die unzähligen Leiden eines jeden Wesens zu beenden und jedem einzelnen Wesen unschätzbare Tugenden zu verschaffen wünscht?
(23) Wer hat einen Vater oder eine Mutter mit einer solchen Hingabe an das Gute? Und haben sie die Götter, die Weisen oder die Brahmanen?
(24) Wenn diese Wesen bisher nicht einmal im Traum zu ihrem eigenen Nutzen an eine solche Haltung denken, wie sollte sie dann zum Wohle der anderen entstehen?
(25) Wie nur wird dieses nie dagewesene Wunder, diese Hingabe an das Heil der Wesen, das einzigartige Juwel des Geistes geboren, das bei anderen nicht einmal zum eigenem Nutzen entsteht?
(26) Wie könnte man das Verdienst dieses geistigen Juwels ermessen, das die Ursache für die Freude aller Umherwandernden ist, die Arznei gegen das Leiden der Lebewesen?
(27) Schon die bloße Absicht, anderen zu nutzen, ist weitaus verdienstvoller, als den Buddhas zu opfern; um wie viel mehr ist es erst der Einsatz für das Glück aller Wesen?
(28) Obwohl sie den Wunsch haben, dem Leiden zu entgehen, rennen sie geradewegs in ihr Leiden hinein; und obwohl sie ihr Glück wünschen, zerstören sie ihr eigenes Glück, als wäre es ihr Feind.
(29) Wo gibt es einen guten Menschen wie diesen, der die an Glück Armen und von Leiden vielfach Geplagten mit allen Glücksgütern zufriedenstellt, all ihre Schmerzen besänftigt (30) und ihre Verblendung beseitigt? Wo gibt es einen solchen Freund? Oder wo gibt es ein solches Verdienst?
(31) Wenn schon jemand eines gewissen Lobes wert ist, der einen Dienst mit einem Gegendienst erwidert, was soll man dann erst von dem Bodhisattva sagen, der unaufgefordert Gutes tut?
(32) Die Leute verehren jemanden schon als einen Wohltäter, wenn er einige wenige Wesen mit einer gewöhnlichen Mahlzeit versorgt, ihnen kurzfristig ein kärgliches Mahl zukommen lässt und herablassend damit einen halben Tag lang ihre Mägen füllt.
(33) Was muss man dann erst von dem unablässig Freigebigen sagen, der über lange Zeit einer unendlichen Zahl von Wesen die unübertroffene Glückseligkeit der Sugatas und damit die vollkommene Erfüllung all ihrer Wünsche gewährt?
(34) Wer gegen einen solchen Gastgeber, einem Kind der Buddhas, Übles im Sinn hat, wird für so viele Äonen lang in der Hölle bleiben, wie er unreine Gedanken gehegt hat. So hat der Beschützer11 gelehrt.
(35) Doch wessen Gedanken [gegenüber dem Bodhisattva] rein sind, der wird daraus noch viel größere Früchte ernten. Selbst durch große Widrigkeiten entsteht bei den Kindern der Sieger nichts Unheilsames; stattdessen wächst das Heilsame unwillkürlich an.12
(36) Ich verneige mich vor dem Körper jener [Bodhisattvas], die dieses ausgezeichnete Juwel des Geistes offenbart haben. Und ich nehme Zuflucht zu jenen Quellen der Glückseligkeit, die selbst jene mit Glück verbinden, die ihnen Schaden zugefügt haben.
2. Bekenntnis der Übel
(1) Um jene kostbare Geisteshaltung anzunehmen, bringe ich den vollendeten Tathāgatas sowie dem makellosen Juwel der edlen Lehre und den Kindern der Buddhas, die wie Meere guter Eigenschaften sind, in rechter Weise dar:
(2) So viele Blumen und Früchte es gibt, die vielfältigen Heilkräuter, die kostbaren Substanzen in der Welt und was immer es an reinen und schönen Gewässern gibt;
(3) Edelsteinberge, einsame und malerische Waldlandschaften, Pflanzen mit reicher Blütenpracht, Bäume, deren Zweige sich vom Gewicht ihrer guten Früchte biegen; (4) Wohlgerüche, Duftessenzen, alle Wünsche erfüllende und mit Juwelen verzierte Bäume in den Welten der Götter und anderswo, Ernten, die ohne Pflügen gedeihen, und alles Schöne, das der Opfergabe wert ist; (5) Seen und Teiche, geschmückt mit Lotosblumen, wo der reizende Gesang der Schwäne erklingt: Alle diese [Gaben] in den unendlichen Weiten des Raumes, die niemandem gehören,
(6) erfasse ich im Geist und bringe sie den Buddhas, den besten unter den Menschen, und den Bodhisattvas dar. Mögen diese edlen Gäste meiner Darbringungen in ihrem großem Mitgefühl barmherzig an mich denken und diese meine Gaben annehmen.
(7) Ohne Verdienste bin ich mittellos; deshalb habe ich keine anderen Reichtümer darzubringen. Mögen daher die Beschützer, die ganz an das Heil der anderen denken, diese Gaben durch ihre Fähigkeit zu meinem Wohl annehmen.
(8) Den Siegern und ihren Söhnen gebe ich mich ganz und bedingungslos hin. Nehmt Besitz von mir, ihr erhabenen Wesen; hingebungsvoll mache ich mich zu eurem Diener.
(9) Von euch in Besitz genommen, habe ich im Dasein nichts mehr zu fürchten. Ich tue, was dem Wohl der Wesen dient, lasse die Übel der Vergangenheit hinter mir und werde andere Übel nicht wieder begehen.
(10) In duftenden Badehäusern, die mit ihren glänzenden Kristallböden und den mit funkelnden Edelsteinen besetzten Säulen das Herz entzücken, und die geschmückt sind mit Baldachinen, die von ihrem Perlenbesatz funkeln, (11) bereite ich den Tathāgatas und ihren Söhnen aus vielerlei kostbaren Krügen ein Bad, gefüllt mit angenehmem, duftendem Wasser, begleitet von Musik und Gesang.
(12) Ich trockne ihre Körper mit exquisiten, herrlich duftenden und frischen Tüchern und bringe ihnen auserlesene, vollendet gefärbte und angenehm duftende Gewänder als Kleidung dar.
(13) Mit mannigfaltigen feinen und weichen himmlischen Gewändern und mit hundert Arten von erlesenem Geschmeide schmücke ich die Heiligen Samantabhadra, Ajita13, Mañjuśrī, Lokeśvara und auch die anderen [Bodhisattvas].
(14) Mit den kostbarsten Duftessenzen, deren Wohlgerüche sich in sämtlichen dreitausend Welten ausbreiten, salbe ich die Körper aller Buddhas, die strahlen wie der Lichtglanz von gereinigtem, poliertem und gewaschenem Gold.
(15) Mit allen Arten von duftenden, reizenden Blumen, wie Māndārava, blauem Lotos und Jasmin, sowie mit prachtvoll geflochtenen Girlanden verehre ich die Buddhas, die höchsten Gäste für Darbringungen.
(16) Auch opfere ich ihnen Wolken von herrlichem Räucherwerk, das einen angenehmen Duft verbreitet. Ebenso bringe ich ihnen zum Genuss göttliche Festmahle dar vielerlei Speisen und Getränken.
(17) Dann opfere ich ihnen mit Edelsteinen besetzte Lampen, die sich in aufgereihten, goldenen Lotosblüten befinden; und auf den mit Duftwasser besprengten ebenen Böden streue ich Mengen feiner, prachtvoller Blütenblätter aus.
(18) Denen, deren Wesen das Mitgefühl ist, bringe ich strahlende Himmelspaläste dar, in denen melodische Lobgesänge erklingen, die mit hängenden Girlanden aus Perlen und Edelsteinen verschönert sind und die Weiten des Raumes schmücken.
(19) Ich schenke den großen Heiligen immerzu prachtvolle hohe und mit Perlen reizvoll umsäumte Schirme mit goldenen Stöcken.
(20) Möge es außerdem noch Wolken von Opfergaben geben, mit herzerfreuenden Wohlklängen von Instrumentalmusik und Gesang, die die leidenden Wesen beglücken.
(21) Mögen auf alle Juwelen der edlen Lehre, auf die Reliquienschreine und die Bildnisse ununterbrochen Edelsteine, Blumen und andere [Gaben] herabregnen!
(22) So wie Mañjughoṣa und die anderen [Bodhisattvas] die Sieger verehren, so verehre auch ich die beschützenden Tathāgatas und ihre Söhne.
(23) Ich preise diese Ozeane von Tugenden mit Meeren von vielstimmigen Lobgesängen. Mögen daraus überall Wolken wohlklingender Lobeshymnen zu ihnen emporsteigen.
(24) So viele Teilchen es in den Bereichen des Universums gibt, so viele Male werfe ich mich nieder vor allen Buddhas der drei Zeiten, vor der Lehre und der besten aller Gemeinschaften.
(25) Ich verneige mich vor den Stätten des Strebens nach dem Erwachen und vor den Reliquienschreinen. Ebenso zolle ich den Äbten, Meistern und den vorzüglichen Weltentsagern Respekt.
(26) Bis ich die Essenz des Erwachens verwirklicht habe, nehme ich Zuflucht zu den Buddhas. Ich nehme Zuflucht zur Lehre und zur Gemeinschaft der Bodhisattvas.
(27) Mit gefalteten Händen wende ich mich an die vollendeten Buddhas und die Bodhisattvas, die in allen Richtungen verweilen und das große Mitgefühl besitzen:
(28) Seit anfangsloser Zeit im Daseinskreislauf, in diesem und in anderen Leben, habe ich unbedacht unheilsame Handlungen selbst begangen oder andere dazu verleitet, (29) und ich habe mich, überwältigt von den Täuschungen der Unwissenheit, daran erfreut. Was immer ich Unheilsames getan habe, erkenne ich als Fehler und bekenne es aufrichtig vor den Beschützern.
(30) [Ich bereue] all jene Handlungen, die ich aus Verblendung mit Körper, Rede und Geist gegenüber den Drei Juwelen, den Eltern oder anderen Respektspersonen begangen habe.
(31) All das schreckliche Böse, das ich ‒ ein von Fehlern gebrochener Übeltäter ‒ begangen habe, bekenne ich vor euch, ihr Führer.
(32) Ich werde zugrunde gehen, bevor ich mich von meinen Übeln geläutert habe! Bitte beschützt mich schnell, damit ich davon sicher befreit werde!14
(33) Der unberechenbare Herr des Todes wartet nicht, ob man etwas getan hat oder nicht. Ob man krank ist oder gesund, niemals kann man diesem flüchtigen Leben trauen.
(34) Weil ich nicht erkannte, dass ich alles zurücklassen und gehen muss, habe ich um der Geliebten und der Ungeliebten willen viele Arten unheilsamer Handlungen begangen.
(35) Die Ungeliebten werden nicht mehr sein, die Geliebten werden nicht mehr sein, auch ich werde nicht mehr sein ‒ nichts wird mehr sein.
(36) Wie in einer Traumerfahrung werden alle Erlebnisse zu bloßen Erinnerungen. Alles Vergangene wird nicht mehr gesehen.
(37) Selbst in dieser kurzen Zeit meines Lebens sind viele Geliebte und Ungeliebte gegangen; doch das Übel, das ich ihretwillen angehäuft habe, steht schrecklich vor mir.
(38) Weil ich nicht erkannt habe, dass ich ein Durchreisender bin, habe ich aus Verblendung, Begierde und Hass vielfaches Unrecht begangen.
(39) Tag und Nacht braucht sich dieses Leben ohne Unterbrechung auf und keine Zeit kommt hinzu. Wie sollte da jemand wie ich nicht sterben?
(40) Während ich da auf meinem Bett liege, und wenn mich auch all meine Verwandten und Freunde umgeben, muss ich doch den Schmerz des Sterbens ganz allein erleben.
(41) Wenn ich von den Boten des Herrn des Todes ergriffen werde, was helfen mir dann meine Verwandten, was nützen mir meine Freunde? Dann würden mich allein die Verdienste schützen ‒ doch um diese habe ich mich nicht bemüht.
(42) O Beschützer, weil ich Leichtsinniger diese Gefahr nicht bedacht habe, habe ich um der vergänglichen Dinge dieses Lebens willen viel Übles begangen.
(43) Verfallen ist der Mensch, der heute zu der Stätte geführt wird, wo man ihm ein Glied abhackt; sein Mund ist ausgetrocknet, sein Blick entstellt, seine ganze Erscheinung entsetzlich.
(44) Was aber wird erst sein, wenn mich die furchtbar anzusehenden Boten des Herrn des Todes packen? Von schrecklichem Angstfieber befallen werde ich gewiss in einem elendigen Zustand sein.
(45) „Wer kann mich vor diesem schrecklichen Grauen bewahren?“ ‒ So werde ich mit weit aufgerissenen, angstvollen Augen die vier Himmelsrichtungen nach Schutzmöglichkeiten absuchen.
(46) Und nachdem ich in den vier Richtungen keinen Schutz gefunden habe, werde ich in Verzweiflung geraten. Was kann ich in dieser Lage, ohne Zuflucht, noch tun?
(47) Deshalb nehme ich von heute an Zuflucht zu den Siegern, den Beschützern der Welt, die sich dafür einsetzen, die Lebewesen zu behüten, den Starken, die alle Furcht beseitigen.
(48) Ebenso nehme ich von ganzem Herzen Zuflucht zu dem Dharma, den sie erkannt haben und der die Gefahren des Daseinskreislaufs beendet, sowie zu der Gemeinschaft der Bodhisattvas.
(49) Aus Angst angesichts der Gefahr gebe ich mich Samantabhadra hin, und auch Mañjughoṣa bringe ich mich aus eigenem Wunsch dar.
(50) An den Beschützer Avalokiteśvara, der in seinem mitfühlenden Handeln unfehlbar ist, richte ich einen verzweifelten Hilferuf. Möge er mich Übeltäter beschützen!
(51) Schutz suchend richte ich an die Heiligen Ākāśagarbha, Kṣitigarbha und all die anderen Beschützer mit großem Mitgefühl aus ganzem Herzen meinen Hilferuf.
(52) Ich nehme Zuflucht zu Vajrapāṇi, bei dessen Anblick die Boten des Herrn des Todes und all die anderen bösen Kräfte vor Entsetzen in die vier Himmelsrichtungen entfliehen.
(53) Bisher habe ich euren Rat übergangen; jetzt sehe ich die große Gefahr und nehme voller Furcht zu euch meine Zuflucht. Beseitigt die Gefahr schnell!
(54) Selbst wenn man eine gewöhnliche Krankheit fürchtet, muss man sich nach den Anweisungen des Arztes richten – um wie viel mehr, wenn man chronisch von der Krankheit der Begierde und [der übrigen Leidenschaften] befallen ist, die hundertfache Übel bringt?
(55) Schon ein einziges dieser [Geistesgifte] genügt, um alle Menschen in Jampudvīpa dahinzuraffen, und in allen Himmelsrichtungen findet sich kein anderes Heilmittel dagegen.
(56) Und dennoch will ich die Vorschrift des allwissenden, alle Schmerzen tilgenden Arztes dazu ignorieren. Welche zutiefst verblendete, verwerfliche Einstellung!
(57) Schon an einem kleinen, gewöhnlichen Abgrund muss man sich vorsichtig bewegen; um wie viel mehr erst an dem Abgrund, in den man Tausende Meilen tief fällt, und aus dem es für lange Zeit [kein Entrinnen gibt].
(58) „Gerade heute werde ich schon nicht sterben.“ Diese Behaglichkeit ist unangebracht. Unausweichlich wird die Stunde kommen, da ich nicht mehr sein werde.
(59) Wer könnte mir Furchtlosigkeit gewähren? Wie sollte ich der [Gefahr] entrinnen? Wie kann ich sorglos bleiben, wenn ich ganz sicher sterben werde?
(60) Was ist mir geblieben von all dem, das verging, kaum dass es erlebt war, und woran ich so sehr hing, dass ich darum den Rat meiner Meister in den Wind geschlagen habe?
(61) Dieses Leben, meine Verwandten und meine Freunde muss ich zurücklassen und allein an einen unbekannten Ort gehen. Wozu all die Freunde und Feinde?
(62) „Aus dem Unheilsamen entsteht Leiden. Wie kann ich mich davon befreien?“ Es ist richtig, wenn ich Tag und Nacht immer nur das denke.
(63) All das Übel, das ich Unwissender aus Verblendung angehäuft habe, durch Handlungen, die von Natur her unheilsam oder wegen der [Verletzung einer Ordens-]Regel abzulehnen sind,
(64) bekenne ich offen vor den Augen der Beschützer, während ich mich mit gefalteten Händen voller Furcht vor dem Leiden wieder und wieder vor ihnen niederwerfe.
(65) Möget ihr Führer meine schlechten Taten als Fehler erkennen! Sie sind verwerflich, und ich will sie nicht wieder begehen.
3. Annahme des Strebens nach dem Erwachen
(1) Mit Freude begrüße ich das Heilsame, das von allen Wesen getan wird, durch das sie Erholung von den Leiden der schlechten Daseinsformen finden. Ich erfreue mich, wenn die mit Leiden Beladenden glücklich leben. Ich erfreue mich an der Anhäufung des Heilsamen, das die Ursache für das Erwachen ist.15
(2) Ich erfreue mich an der Befreiung der Lebewesen aus den Leiden des Daseinskreislaufs. Ebenso erfreue ich mich an dem Erwachen der Beschützer und an den geistigen Ebenen der Bodhisattvas.
(3) Voller Freude befürworte ich ihr Streben nach dem Erwachen ‒ jenen Ozean des Guten, der das Glück aller Lebewesen herbeiführt und das Heil der fühlenden Wesen bewirkt.
(4) Mit gefalteten Händen bitte ich die Buddhas in allen Himmelsrichtungen: Mögen sie die Lampe der Lehre leuchten lassen für die Wesen, die aus Unwissenheit in [den Abgrund] des Leidens gestürzt sind.
(5) Die Sieger, die beabsichtigen, in das Nirvāṇa einzugehen, bitte ich mit gefalteten Händen: Mögen sie diese Welt nicht in Blindheit zurücklassen, sondern für unzählige Zeitalter hier verweilen.
(6) Möge ich durch die heilsame Kraft, die ich mit all diesen Handlungen gesammelt habe, sämtliche Leiden aller fühlenden Wesen zur Ruhe bringen.
(7) Solange es in der Welt Kranke gibt und ihre Krankheiten nicht geheilt sind, möge ich ihre Medizin, ihr Arzt und ihr Krankenpfleger sein.
(8) Möge ich Speisen und Getränke niederregnen lassen und damit alle Qualen von Hunger und Durst löschen. Möge ich in Zeitaltern der Hungersnöte selbst zu Speise und Trank werden!
(9) Möge ich für die armen, mittellosen Wesen zu einem unerschöpflichen Schatz werden; mögen ich ihnen in Gestalt vielfältiger Lebensgüter zur Verfügung stehen.
(10) Körper, Güter und alles Heilsame der drei Zeiten gebe ich ohne Bedauern hin, um das Wohlergehen aller Lebewesen zu verwirklichen.
(11) Durch das Aufgeben von allem wird das Nirvāṇa erlangt, und mein Geist wünscht ja, das Nirvāṇa zu erreichen. Wenn ich ohnehin alles aufgeben muss, ist es am besten, es den Lebewesen zu geben.
(12) Ich habe meinen Körper bereits allen Wesen hingegeben für alles, was ihnen Glück bereitet; mögen sie mich also ruhig töten, beschimpfen oder schlagen.
(13) Sie mögen ruhig mit meinem Körper spielen, mich zum Gegenstand von Spott und Hohn machen. Wie sollte es mich kümmern, wenn ich diesen Körper bereits hingegeben habe?
(14) Sollen sie mich für alle Werke einsetzen, sofern es nicht zum Schaden gereicht. Möge die Beziehung zu mir für niemanden jemals nutzlos sein.
(15) Bei denen, die zornig auf mich sind oder die mir vertrauen, möge dies stets eine Ursache dafür sein, dass sie all ihre Ziele erreichen!
(16) Sollen die einen mich verhöhnen, die anderen mir Schaden zufügen und wieder andere über mich lästern: Möge ihnen allen das Erwachen zuteil werden!
(17) Möge ich den Schutzlosen ein Beschützer sein, ein Führer jenen, die sich auf dem Weg befinden. Möge ich jenen, die [ein Wasser] zu überqueren wünschen, ein Schiff, ein Floß und eine Brücke sein.
(18) Möge ich eine Insel sein für jene, die eine Insel wünschen, ein Licht jenen, die Helligkeit brauchen, eine Liegestatt jenen, die liegen müssen, und ein Diener den Wesen, die einen Diener wünschen.
(19) Möge ich für die Wesen ein Wunsch erfüllendes Juwel, ein Glückskrug, ein Zauberspruch, eine große Medizin, ein Wunderbaum und eine Wunsch erfüllende Kuh sein.
(20) Wie die Erde und die anderen großen Elemente und wie der Raum, möge ich stets die Grundlage für vielfältige Güter zum Unterhalt von unzähligen Wesen sein.
(21) Möge ich ebenso in all den Bereichen der Wesen, die sich in den endlosen Raum ausdehnen, in jeder Weise die Ursache für ihren Lebensunterhalt sein, bis sie alle das Nirvāṇa erreicht haben.
(22) So wie die Sugatas der Vergangenheit das Streben nach dem Erwachen erzeugt und sich dann schrittweise den Übungen der Bodhisattvas gewidmet haben,
(23) will auch ich zum Nutzen der Lebewesen den Wunsch nach dem Erwachen hervorbringen und ebenso die Schulungsregeln schrittweise üben. (24) Nachdem der Kluge in dieser Weise mit reinem Bewusstsein das Streben nach dem Erwachen angenommen hat, möge er diese Geisteshaltung in folgender Weise loben, um sie weiter zu fördern:
(25) Nun trägt mein Leben Frucht. Ich habe das menschliche Dasein wohl erlangt; heute bin ich in die Familie der Buddhas geboren und zu einem Kind der Buddhas geworden.
(26) Von nun an will ich mit ganzer Kraft im Einklang mit dieser Familie handeln und mich so verhalten, dass ich diese makellose, edle Familie nicht beschmutze.
(27) So, wie ein Blinder in einem Haufen Unrat einen Edelstein findet, ist in mir wie durch eine glückliche Fügung dieses Streben nach dem Erwachen entstanden.
(28) Dieses [Streben nach dem Erwachen] ist das vortreffliche Elixier, das den Herrn des Todes der Lebewesen bezwingt. Dieses ist auch der unerschöpfliche Schatz, der die Armut der Wesen beseitigt.
(29) Dieses ist auch die beste Arznei, welche die Lebewesen von allen Krankheiten heilt. Es ist der Baum, unter dem die Lebewesen, die vom Umherziehen auf den Straßen des Daseins erschöpft sind, Erholung finden.
(30) Es ist die für alle Lebewesen geöffnete Brücke, um die schlechten Daseinsformen zu überqueren. Es ist für den Geist der aufgehende Mond, der die Hitze der Leidenschaften der Welt kühlt.
(31) Es ist die große Sonne, welche die Trübung des Nichtwissens dauerhaft aus der Welt verbannt. Es ist die Essenz der Butter, entstanden aus dem Schlagen der Milch der Lehre.
(32) Für die Karawane der Lebewesen, die auf der Suche nach dem Genuss des Glücks auf den Straßen des Daseins umherzieht, ist damit das beste Glücksmahl zubereitet, das die große Reisegesellschaft der Wesen zufrieden stellt.
(33) Heute habe ich vor den Augen aller Beschützer die Welt zur Sugataschaft und, auf dem Weg dorthin, zu [weltlichem] Glück eingeladen. Mögen sich die Götter, Geister und die anderen [Wesen] darüber freuen! Anmerkung zu den Versen
4. Achtsame Sorge um das Streben nach dem Erwachen
(1) Nachdem ein Kind der Sieger in dieser Weise das Streben nach dem Erwachen fest ergriffen hat, sei es stets und ohne nachzulassen bemüht, die Übungsregeln nicht zu verletzen.
(2) Bei Aufgaben, die man spontan oder ohne gründliche Prüfung begonnen hat, ist es angebracht, sich zu überlegen, ob man sie tun oder lassen sollte, selbst wenn man bereits ein Versprechen abgegeben hat.
(3) Doch was gibt es mit angesichts dieser Aufgabe zu zögern, welche die Buddhas und ihre Nachfolger mit ihrer großen Weisheit geprüft haben und die ich auch selbst immer wieder von allen Seiten betrachtet habe?
(4) Sollte ich dieses Versprechen nun nicht in die Tat umsetzen, so würde ich damit alle Wesen betrügen ‒ welches Schicksal wird mir dann zuteil werden?
(5) Es heißt, dass schon jener Mensch, der zunächst im Geist die Absicht hatte zu geben, es dann aber doch nicht tut, zu einem Hungergeist wird, auch wenn es sich nur um eine geringe Sache handelt.
(6) Wie sollte mir ein glückliches Dasein zuteil werden, wenn ich alle Lebewesen um die unübertroffene Glückseligkeit bringe, zu der ich sie von ganzem Herzen eingeladen habe?
(7) Nur ein Allwissendender kennt jenes unergründliche Wirken der Tat (karman), das selbst jene Menschen Befreiung erreichen lässt, die das Streben nach dem Erwachen aufgegeben haben.
(8) Deshalb wiegen für den Bodhisattva Verfehlungen besonders schwer; denn wenn sie vorkommen, wird [nicht nur] das Wohl [eines, sondern das] aller Wesen beeinträchtigt.
(9) Wenn einer auch nur einen Moment lang dem Verdienst eines [Bodhisattvas] ein Hindernis bereitet, so wird er unendliche Zeiten in schlechten Daseinsformen [umherwandern], denn er schwächt [dessen Wirken] für das Wohl der Wesen.
(10) Wenn man sich selbst schon dadurch zugrunde richtet, dass man das Glück eines einzigen Wesens zunichte macht, um wie viel mehr erst, wenn man das Glück der Lebewesen zerstört, welche die unendlichen Weiten des Raums bevölkern?
(11) Wenn [der Bodhisattva] im Daseinskreislauf hin und her geworfen wird, weil sich die Kraft der Verfehlungen und die Kraft des Strebens nach dem Erwachen abwechseln, wird dadurch für lange Zeit verhindert, dass er die spirituellen Ebenen erreicht.
(12) Deshalb werde ich mit Hingabe das praktizieren, was ich versprochen habe. Denn wenn ich von heute an keine Anstrengungen unternehme, werde ich tiefer und tiefer sinken.
(13) Obwohl schon unzählige Buddhas, die zum Nutzen der Lebewesen wirkten, wieder gegangen sind, bin ich doch aufgrund meiner eigenen Fehler nicht in den Genuss ihrer Heilkunst gekommen.
(14) Wenn ich jetzt weitermache wie bisher und das Gleiche immer wieder geschieht, werde ich erneut in die schlechten Daseinsbereiche geraten und Krankheit, Tod, Verstümmelung und Zerfleischung erleben.
(15) Wann sollte ich dann jemals wieder solche seltenen Umstände erreichen: dass ein Vollendeter erschienen ist, dass ich Vertrauen besitze, ein Menschenleben erlangt habe und fähig bin, mich an das Heilsame zu gewöhnen?
(16) Auch an einem Tag wie heute, an dem ich gesund bin, genug zu essen habe und mich nichts plagt, ist das Leben nur ein trügerischer Augenblick. Der Körper ist wie eine kurzzeitige Leihgabe.
(17) Wenn ich mich derart verhalte, werde ich nicht einmal einen menschlichen Körper wiedererlangen. Ohne einen menschlichen Körper aber gibt es nur Übel und nichts Heilsames.
(18) Tue ich das Heilsame nicht dann, wenn ich dazu in der Lage bin, wie will ich es jemals vollbringen, wenn ich durch die Leiden in einer schlechten Daseinsform verwirrt bin?
(19) Wenn ich das Heilsame unterlasse und das Übel anhäufe, so werde ich selbst in hundert Millionen Zeitaltern nicht einmal das Wort „glückliches Dasein“ hören.
(20) Deshalb hat der Erhabene gelehrt, dass das Menschsein so schwer zu erlangen ist, wie es für eine Schildkröte schwierig ist, ihren Hals in die Öffnung eines Jochbalkens zu stecken, der auf dem Ozean hin- und hergeworfen wird.
(21) Es verbringt schon jemand ein Zeitalter in der [Hölle] Avīci, weil er in einem einzigen Moment unheilsam gehandelt hat. Muss dann erwähnt werden, dass man angesichts der schlechten Taten, die man seit anfangsloser Zeit im Daseinskreislauf angehäuft hat, nicht in ein glückliches Dasein gelangen wird?
(22) Allein dadurch, dass man das [Leiden] nun erleben muss, wird man noch nicht befreit. Denn noch während man es erlebt, entstehen viele weitere Übeltaten.
(23) Wenn ich einmal diese Freiheit gefunden habe und mich dann nicht an das Heilsame gewöhne, so gibt es keinen größeren Betrug und keine größere Verblendung.
(24) Wenn ich dies aber erkannt habe und doch weiter aufgrund meiner Verblendung in die Untätigkeit absinke, wird mich, wenn einst die Stunde des Todes kommt, großer Kummer überwältigen.
(25) Wenn mein Körper lange Zeit in den unerträglichen Höllenfeuern brennt, wird mein Geist unweigerlich von der Hitze schrecklicher Reue gequält werden.
(26) Jetzt habe ich auf mir unbegreifliche Weise diesen so schwer zu erlangenden Boden des Heils gefunden. Wenn ich mich nun wissentlich erneut in die Höllen bringe, (27) so habe ich gewiss den Verstand verloren ‒ wie einer, der durch einen Zauberspruch verwirrt ist. Ich weiß selbst nicht, was mich da verblendet; ich weiß nicht, was da in mir wohnt.
(28) Meine Feinde wie Hass und Verlangen haben weder Füße noch Hände, und sie sind weder mutig noch klug. Wie können sie mich dann wie einen Sklaven halten?
(29) Ihnen aber, die mir nach Belieben Schaden zufügen, während sie in meinem Geist wohnen, mit Geduld statt mit Zorn zu begegnen, ist eine unangemessene Nachsicht und tadelnswert.
(30) Selbst wenn sich alle Götter und Menschen als Feinde gegen mich stellten, so könnten sie mich doch nicht in das Feuer der schlimmsten Hölle werfen, (31) das so stark ist, dass es selbst den Weltenberg in ein Häufchen Asche verwandelt. Doch diese mächtigen Feinde, die Leidenschaften (kleśa), stoßen mich in einem Moment dort hinein.
(32) Von allen Feinden ist niemand so ausdauernd wie jene hartnäckigen, anfangs- und endlosen Feinde, meine Leidenschaften.
(33) Alle bringen Nutzen und Wohlergehen, wenn man ihnen entgegenkommt und in angemessener Weise einen Dienst erweist. Doch wenn man den Leidenschaften gegenüber wohlwollend ist, bewirken sie im Gegenzug nur Schaden und Leiden.
(34) Wie könnte ich mich ohne Furcht am Daseinskreislauf erfreuen, solange diese langlebigen Dauerfeinde in meinem Herzen wohnen, die einzige Ursache, die mit großer Wucht die Masse des Leidens hervorbringt?
(35) Wie könnte ich Glück finden, wenn diese [Leidenschaften] ‒ die Wächter im Gefängnis des Daseinskreislaufs, die Schlächter in den Höllen – im Haus meines Geistes, dem Käfig der Anhaftung, wohnen?
(36) Solange ich daher diese Feinde nicht wirklich vernichtet habe, werde ich hier in meiner Anstrengung nicht nachlassen. Die Stolzen, die einem auch nur geringfügigen Schädiger zürnen, ruhen nicht, bevor sie ihn nicht vernichtet haben.
(37) Entschlossen werfen sie sich in vorderster Reihe in die Schlacht, nur um jene Elenden zu vernichten, die ohnehin von Natur her dem Tod geweiht und dem Leiden unterworfen sind. Sie missachten die Schmerzen, wenn sie von Pfeilen und Speeren getroffen werden, und weichen nicht zurück, bis sie ihr Ziel erreicht haben.
(38) Muss man erwähnen, dass ich, der ich mich nun aufgemacht habe, diese natürlichen Feinde, die beständigen Anstifter aller Leiden, zu vernichten, mir dabei selbst durch die Ursachen für Hunderte von Leiden nicht den Mut nehmen lassen und nicht verzagen werde?
(39) Wenn jene sogar die vom Feind sinnlos geschlagenen Wunden an ihrem Körper wie Schmuck tragen, wie könnten die Leiden dann einem wie mir schaden, der sich in rechter Weise aufgemacht hat, das große Heilsziel zu verwirklichen?
(40) Wenn die Fischer, Caṇðālas, Bauern und andere die Mühsal von Kälte und Hitze und dergleichen ertragen und dabei nur an ihren eigenen Lebensunterhalt denken, warum bin ich dann nicht bereit, die [Mühen bei der Überwindung der Leidenschaften] zum Wohle der Lebewesen auf mich zu nehmen?
(41) Während ich gelobe, die Wesen, die so weit sind wie der Himmelsraum in den zehn Richtungen, von Leidenschaften zu befreien, bin ich nicht einmal selbst von Leidenschaften befreit.
(42) Muss der nicht verrückt sein, der so redet, ohne sein eigenes Maß zu kennen? Deshalb werde ich unablässig die Zerstörung der Leidenschaften betreiben.
(43) An diesem [Entschluss] will ich festhalten. Voller Feindschaft will ich sie alle bekämpfen ‒ außer dieser einen Leidenschaft, mit der die Leidenschaften besiegt werden.
(44) Mag ich durch Feuer getötet werden, mag man mich enthaupten ‒ meinen Feinden, den Leidenschaften aber, werde ich mich niemals beugen!
(45) Wenn ein gewöhnlicher Feind zunächst vertrieben ist, kann er in einem anderen Land Stellung beziehen und seine Kräfte sammeln, um dann von dort erneut zuzuschlagen. Doch die Leidenschaften als Feinde haben diese Möglichkeit nicht.
(46) Diese verblendeten Leidenschaften werden mit dem Auge der Einsicht aufgegeben. Wohin sollten sie dann gehen, von woher sollten sie denn zurückkehren, um mich zu schlagen? Nein, nur weil mein Geist schwach ist, bemühe ich mich nicht.
(47) Die Leidenschaften wohnen weder in den Objekten noch in der Gesamtheit der Sinnesorgane, nicht dazwischen und nicht anderswo. Wo halten sich auf, um die ganze Welt zu erschüttern? Wie Trugbilder sind sie. Lass ab von deiner Furcht, mein Herz, und strebe nach Einsicht! Warum quälst du dich sinnlos in den Höllen und anderswo?
(48) Derart entschlossen werde ich mich bemühen, die Regeln zu verwirklichen, wie sie gelehrt wurden. Wie kann ein Kranker gesunden, wenn er mit Heilmitteln behandelt werden muss, aber den Rat des Arztes nicht befolgt?
5. Wachsamkeit
(1) Wer die Regeln der [Bodhisattva-]Übung wahren will, muss sorgsam den Geist behüten. Wer seinen Geist nicht behütet, wird nicht fähig sein, die Übungsregeln zu bewahren.
(2) Ungezähmte, rasende Elefanten richten hier nicht solch ein Unheil an wie der losgelassene Elefant des Geistes in der Hölle Avīci.
(3) Wenn aber der Elefant des Geistes mit dem Seil der achtsamen Vergegenwärtigung fest gebunden ist, gehen alle Gefahren zu Ende und alles Heilsame fällt dir zu.
(4) Tiger, Löwen, Elefanten, Bären, Schlangen und alle Feinde, all die Höllenwächter, bösen Geister und Dämonen ‒
(5) sie alle sind gebunden, wenn nur dieser Geist gebunden ist; sie alle sind gezähmt, wenn nur dieser Geist gezähmt ist. (6) So entstehen alle Gefahren und auch die unermesslichen Leiden aus dem Geist. Dies hat der Verkünder der Wahrheit selbst gelehrt.
(7) Wer hat die Waffen in der Hölle absichtlich gefertigt, wer hat den glühenden Eisenboden geschaffen? Woher stammen die Scharen der Verführerinnen, [die den Untreuen peinigen]?
(8) Der Weise hat gelehrt, dass auch alle derartigen [Leiden] das [Ergebnis] einer übel gesinnten Geisteshaltung sind. Deshalb gibt es in den Drei Welten nichts zu fürchten, außer den Geist.
(9) Bestünde die Vollkommenheit des Gebens darin, dass man die Armut in der Welt überwunden hätte, wie hätten dann die vergangenen Beschützer jemals Vollkommenheit erreicht, wenn die Welt noch heute Mangel leidet?
(10) Es wurde gelehrt: Durch die Motivation, allen Besitz und die Früchte [der Übung] allen Lebewesen hinzugeben, wird die Freigebigkeit vervollkommnet. Sie ist also gewiss eine innere Haltung.
(11) Wohin sollte ich die Fische und [die anderen Wesen] bringen, damit sie nicht getötet werden? Doch wer die Geisteshaltung des Unterlassens [von Schaden] erreicht, erlangt damit die Vollkommenheit der Selbstdisziplin, so wird es gelehrt.
(12) Bösartige Menschen sind so weit wie der Raum; ich kann sie nicht alle besiegen. Aber wenn ich allein meine Wut besiege, gleicht dies dem Sieg über alle Feinde.
(13) Woher soll ich so viel Leder nehmen, um die ganze Erdoberfläche zu bedecken? Doch schon mit dem Leder der Schuhsohlen kann ich gleichsam die ganze Erde bedecken.
(14) Ich kann auch nicht alle unerwünschten äußeren Dinge von mir fernhalten. Doch meinen Geist allein werde ich mäßigen. Wozu muss ich dann noch die anderen Dinge abwehren?
(15) Selbst im Zusammenwirken mit Körper und Rede hat eine schwache [geistige] Tätigkeit nicht jene Wirkung, die ein klarer Gedanke allein hervorbringt, wie den Brahma-Zustand und dergleichen.
(16) All die rituellen Rezitationen und asketischen Praktiken sind von dem Wissenden als nutzlos beschrieben worden, wenn sie mit einem zerstreuten Geist ausgeführt werden, und sei es auch über lange Zeit.
(17) Jene, die den wesentlichen Grund der Gegebenheiten, dieses Geheimnis, den Geist, nicht erkennen, mögen wünschen, Wohlergehen zu erreichen und Leiden zu beenden, doch sie werden auch weiter sinnlos [im Dasein] umherwandern.
(18) Daher werde ich diesen Geist wohl behüten und beschützen. Wozu all die anderen Arten der Disziplin, wenn diese Disziplin, die Zähmung des eigenen Geistes, fehlt?
(19) So wie jemand inmitten einer ausgelassenen Menschenmenge sorgfältig eine Wunde schützt, so sollte auch jener, der sich inmitten von schlechten Leuten aufhält, diese Wunde, den Geist, immerzu behüten.
(20) Wenn ich schon aus Furcht vor dem geringen Wundschmerz sorgsam eine Wunde behüte, warum schütze ich dann nicht meinen verwundbaren Geist angesichts der Bedrohung, von den Bergen in der „Hölle der Zermalmung“ erdrückt zu werden?
(21) Verhält er sich so, wird der Übende, der in seiner Disziplin gefestigt ist, selbst inmitten von bösartigen Menschen oder in einer Schar von reizenden Frauen nicht wanken.
(22) Sollen ruhig mein Besitz, mein Ruf, mein Körper oder mein Lebensunterhalt zugrunde gehen; sollen auch ruhig andere Tugenden abnehmen ‒ meinen Geist werde ich niemals Schaden nehmen lassen!
(23) Mit gefalteten Händen wende ich mich an euch, die ihr euren Geist behüten wollt: Möget ihr Vergegenwärtigung (sm¥ti) und Wachsamkeit (saþprajanya) mit ganzem Herzen bewahren!
(24) So wie ein von einer Krankheit geschwächter Mensch zu keiner Leistung fähig ist, so ist auch derjenige zu keinem [heilsamen] Werk fähig, dessen Denken von mangelnder Wachsamkeit getrübt ist.
(25) Man mag durchaus etwas gelernt, bedacht und meditiert haben. Doch ohne die Wachsamkeit des Geistes wird dieses genauso wenig im Gewahrsein bleiben wie Wasser in einem lecken Krug.
(26) Viele mögen zwar gelehrt, gläubig und bemüht sein, doch sie beschmutzen sich mit moralischen Verfehlungen, weil ihnen der Makel der mangelnden Wachsamkeit anhaftet.
(27) Bei diesen Achtlosen folgen die [Leidenschaften wie] Diebe dem Verlust der Vergegenwärtigung. So gehen sie, selbst wenn sie sich Verdienste erworben hatten, als Bestohlene einem schlechten Schicksal entgegen.
(28) Denn diese Diebesbande von Leidenschaften sucht nach einer günstigen Gelegenheit. Hat sie einmal Zutritt gefunden, stiehlt sie das Heilsame und macht damit ein glückliches Geschick zunichte.
(29) Deshalb darf man die Vergegenwärtigung niemals von der Eingangstür des Denkens entfernen. Und falls sie doch fortgegangen ist, bringe man sie zurück, im Bewusstsein der Qualen der leidvollen Existenzen.
(30) Die Glücklichen entwickeln Respekt durch das Zusammensein mit dem Lehrer, durch die Unterweisungen des Meisters und aus Furcht; bei ihnen entsteht die achtsame Vergegenwärtigung leicht.
(31) „Die Buddhas und Bodhisattvas haben ungehinderte Sicht auf alles. Jederzeit bin ich vor ihrer aller Augen.“
(32) Wer so denkt, dem wird in rechter Weise Schamgefühl, Respekt und Furcht zu eigen sein. Und dadurch wird auch immer wieder die Vergegenwärtigung des Buddhas entstehen.
(33) Wenn die Vergegenwärtigung einmal als Wache an der Eingangstür des Denkens aufgestellt ist, dann kommt die wachsame Selbstprüfung hinzu, und selbst wenn sie einmal fortgehen sollte, wird sie wieder zurückkehren.
(34) In jeder Situation muss ich zuerst betrachten, wie meine Geisteshaltung beschaffen ist und bemerken, wenn diese fehlerhaft ist. In diesem Fall werde ich fest bleiben wie Holz.
(35) Niemals soll mein Blick ziellos umherwandern. Die Aufmerksamkeit gesammelt, will ich stets meinen Blick senken.
(36) Damit das Auge ausruhen kann, mag [der Mönch] zuweilen die Gegend betrachten; und wenn eine andere Person im Blickfeld erscheint, schaue er sie an, um sie zu begrüßen.
(37) Um den Weg und dergleichen auf Gefahren hin zu überprüfen, schaue er regelmäßig in die vier Himmelsrichtungen. In einer Pause richte er den Blick zurück und schaue hinter sich.
(38) [Die Lage] vor und hinter sich im Blick, entscheide er sich zu gehen oder zurückzukehren. So soll er in allen Situationen handeln, nachdem er erkannt hat, was zu tun geboten ist.
(39) Nachdem er eine Handlung mit dem Bewusstsein „so soll die Haltung meines Körpers sein“, geplant hat, soll er dann von Zeit zu Zeit überprüfen, wie sich der Körper tatsächlich verhält.
(40) Mit größter Sorgfalt muss er darauf achten, dass der rasende Elefant des Geistes, wenn er ihn an den großen Pflock des Denkens an die Lehre festgebunden hat, nicht ausbricht.
(41) „Wohin wendet sich mein Denken?“ So soll er den Geist genau überwachen, damit die Bemühung um Konzentration auch nicht einen Moment lang verloren geht.
(42) Ist er aber aufgrund einer Gefahr, bei einer Festlichkeit oder aus ähnlichen Anlässen dazu nicht fähig, mag er nach Belieben handeln. So wurde auch gelehrt, dass man zu Zeiten der Wohltätigkeit die Disziplin vernachlässigen darf.
(43) Man soll den Geist allein darauf richten, was man nach [reiflicher] Überlegung zu tun begonnen hat. Nur das muss man zunächst zu Ende bringen und nicht an etwas anderes denken.
(44) Auf diese Weise wird alles gut getan sein, andernfalls beides nicht. Und so wird auch die untergeordnete Leidenschaft der mangelnden Wachsamkeit nicht weiter anwachsen.
(45) Das Verlangen soll er aufgeben, das entsteht, wenn er auf all den vielfältigen Klatsch und Tratsch und die zahllosen Spektakel trifft.
(46) Wenn er merkt, dass er sinnlose Dinge tut, wie Erde zerkleinern, Gras ausreißen oder Linien in den Boden ziehen, dann soll er sich an die Regeln des Buddhas erinnern und es furchtsam gleich wieder unterlassen.
(47) Wenn in ihm der Wunsch aufkommt, sich zu bewegen oder zu reden, dann soll er zuerst den eigenen Geist überprüfen und innerlich gefestigt sich so verhalten, wie es recht ist.
(48) Wenn im Geist ein Impuls von Verlangen oder Wut aufkommt, dann soll er weder handeln noch reden, sondern verharren wie Holz.
(49) Wenn das Denken geprägt ist von Übermut, Spott, Hochmut oder Selbstgefälligkeit, von dem Wunsch, andere bloßzustellen, von Heuchelei oder Hinterlist,
(50) wenn es das eigene Ich loben und andere tadeln will, wenn es beleidigend oder streitsüchtig ist, dann soll er verharren wie Holz. (51) Wenn mein Denken nach Gewinn, Ehre und Ruhm trachtet, wenn es nach Dienern und Anhängerschaft strebt, oder wenn es auf Ehrbekundungen aus ist, dann werde ich wie Holz verharren.16
(52) Wenn mein Denken das Wohl der anderen missachten und meinen eigenen Vorteil erreichen will, oder wenn es [sich durch] Reden [hervortun] will, dann werde ich verharren wie Holz.
(53) Wenn mein Geist unduldsam, faul, ängstlich, anmaßend oder geschwätzig ist, oder wenn er parteiisch ist für die eigene Seite, dann werde ich wie Holz verharren.
(54) Wenn der beherzte [Bodhisattva] das Denken so geprüft hat und erkennt, dass es von Leidenschaften befleckt ist oder nutzloser Tätigkeit nachgeht, dann soll er es mit den Gegenmitteln wieder fest in den Griff bekommen.
(55) Entschlossen will ich sein, klar, gefestigt, respektvoll, höflich, mit Schamgefühl und [Gewissens]scheu versehen. Ruhig, darauf bedacht, die Herzen der anderen zu erfreuen,
(56) will ich unbeirrt bleiben von den widerspruchsvollen Wünschen der Unreifen und liebevoll in dem Wissen, dass diese durch die Leidenschaften in ihnen entstanden sind.
(57) In allen untadeligen Angelegenheiten will ich mich ganz mir selbst und den anderen widmen und dabei das Denken stets frei vom Ich-Wahn halten, indem ich [die Dinge] wie eine magische Schöpfung [betrachte].
(58) Immer wieder bedenkend, dass ich nach langer Zeit diese höchste Freiheit [der menschlichen Existenz] erlangt habe, werde ich den Geist so unerschütterlich halten wie den [Weltenberg] Sumeru.
(59) Einst, wenn die Geier, gierig nach Aas, ihn hin- und her zerren werden, wird der Körper sich nicht dagegen auflehnen. Warum also verherrlichst du ihn jetzt?17
(60) Warum, mein Geist, betrachtest du diesen Körper als das Deine und beschützt ihn? Wozu soll er dir nützen, wenn du und er doch verschieden sind?
(61) Du verwirrter Geist! Warum nimmst du nicht lieber eine saubere Holzpuppe [und betrachtest sie als „meinen“ Körper]? Warum behütest du diesen aus unreinen Stoffen zusammengefügten, zur Verwesung bestimmten Apparat?
(62) Mit deinem Verstand entferne zuerst diese Hautschicht. Trenne dann mit dem Skalpell der Einsicht das Fleisch vom Knochengerüst.
(63) Nachdem du auch die Knochen gespalten hast, schaue bis ins Mark hinein. Siehe selbst: Wo gibt es hier einen Kern?
(64) Hast du so sorgfältig gesucht und doch keinen Kern gefunden, sage, warum hütest du noch immer diesen Körper aus Verlangen?
(65) Du kannst seine Unreinheiten nicht essen, sein Blut nicht trinken, seine Eingeweide nicht schlürfen. Was soll dir der Körper nützen?
(66) Doch ist es gewiss angemessen, ihn als Fraß für die Schakale und Geier zu schützen! Dieser ganze menschliche Körper taugt zu nichts anderem, als ihn zu nützlichen Aufgaben zu bewegen.
(67) Auch wenn du ihn derart behütest, er wird dir vom unbarmherzigen Tod entrissen und den Vögeln und Hunden vorgeworfen werden. Was kannst du dann dagegen tun?
(68) Einem Diener, der sich nicht zur Arbeit bewegen lässt, gibt man auch keinen Lohn wie Kleidung und so weiter. Dieser Körper aber verlässt dich sogar, obwohl du ihn genährt hast. Warum verausgabst du dich dermaßen darin, ihn zu unterhalten?
(69) So gib ihm also seinen Lohn, und verwende ihn dann zu deinem eigenen Wohl. Überlasse ihm nicht alles, was du hast, wenn er dir keinen Nutzen bringt.
(70) Betrachte den Körper als Schiff, als bloße Stütze, um zu gehen und zu kommen; verwandle ihn in einen Wunsch erfüllenden Körper, um das Heil der Lebewesen zu bewirken.
(71) In solcher Weise Herr seiner Selbst, möge [der Bodhisattva] stets ein freundlich lächelndes Gesicht zeigen, düsteres Stirnrunzeln unterlassen und für die Welt ein Freund und dabei geradlinig sein.
(72) Stühle und dergleichen soll er nicht lärmend und hastig absetzen, Türen nicht heftig aufreißen; stets erfreue er sich an Zurückhaltung.
(73) Reiher, Katze und Dieb bewegen sich lautlos und unauffällig und erreichen so ihr Ziel. Ein Übender möge sich stets so verhalten.
(74) Respektvoll nehme er die Worte jener an, die in der Ermahnung anderer erfahren und die unaufgefordert hilfsbereit sind. Stets möge er der Schüler aller sein.
(75) Bei allem, was gut und richtig gesagt wurde, drücke er seine Wertschätzung aus. Sieht er jemanden Gutes tun, ermutige er ihn durch Lob.
(76) Über die Vorzüge [anderer] rede er im Privaten; wenn sie [aber öffentlich] ausgesprochen werden, bekunde er seine Zustimmung.18 Werden die eigenen Tugenden genannt, so werte er dies als Anerkennung guter Eigenschaften.
(77) Das Ziel aller menschlichen Bemühungen ist die Zufriedenheit; doch diese wird auch mit Reichtümern nur selten erkauft. Also genieße ich das Glück der Zufriedenheit über das Gute, das andere getan haben.
(78) So habe ich schon in diesem [Leben] keinen Verlust und gewinne auch noch große Glückseligkeit für das jenseitige. Durch schlechte Gefühle [von Missgunst] aber erlebe ich [jetzt] das Leiden der Unzufriedenheit und dazu noch großes Leiden nach diesem Leben.
(79) Er rede vertrauenswürdig, zusammenhängend, verständlich, angenehm, frei von Gier und Hass, freundlich und in rechtem Maße.
(80) Im Kontakt mit den Wesen sei er liebevoll und schaue sie mit dem Gedanken an: „Allein auf sie gestützt werde ich die Buddhaschaft verwirklichen.“
(81) Große heilsame Kraft entsteht durch jene [Werke], denen er sich ausdauernd widmet, für die er sich mit ganzem Herzen einsetzt oder bei denen er die Gegenmittel anwendet, aber auch durch [gute] Werke gegenüber den Feldern der Vorzüge und der Wohltäter oder gegenüber Notleidenden.
(82) Stets soll er seine Werke kundig und mit Zuversicht selbst erledigen. Bei allen Aufgaben verlasse er sich nicht auf andere.
(83) Was die Tugenden auf dem Weg zur Vollkommenheit betrifft, beginnend mit der Freigebigkeit [gefolgt von moralischer Selbstdisziplin, Geduld, Tatkraft, Sammlung und Weisheit], so sind die letzteren jeweils höher zu bewerten [als die vorhergehenden]. Man soll die höherwertigen nicht zugunsten der geringeren vernachlässigen. Am wichtigsten aber ist das Denken an das Wohl der anderen.
(84) Mit dieser Erkenntnis möge er sich stets für das Wohl der anderen einsetzen. Jenen [die dem Bodhisattva-Pfad folgen] hat der Mitleidsvolle in seiner Weitsicht sogar Handlungen erlaubt, die gewöhnlich untersagt sind.19
(85) [Als Bettelmönch] teile er [die Almosen] mit den niedrigen [Lebewesen], mit den Schutzlosen und mit den Mitbrüdern. Er esse in Maßen und gebe [alle seine Güter] hin, ausgenommen sein dreifaches Mönchsgewand.
(86) Den Körper, mit dem er den edlen Dharma ausübt, schädige er nicht für einen geringen [Dienst]. Dann wird er schnell die Hoffnungen der Lebewesen erfüllen können.
(87) Solange die Haltung des Mitgefühls nicht rein ist, gebe er diesen Körper nicht hin. Als Ursache, um ein großes Ziel zu erreichen, sei es in diesem oder einem anderen [Leben], soll er ihn aber unbedingt hingeben.
(88) Er soll die Lehre nicht [Zuhörenden] vortragen, die respektlos sind, die, ohne krank zu sein, einen Turban tragen, die einen Schirm, einen Stock oder eine Waffe tragen oder den Kopf bedecken.
(89) Ebenso unterrichte er nicht jene mit geringerer Neigung in den tiefgründigen und umfassenden [Lehren des Mahāyāna] und nicht Frauen ohne Begleitung eines Mannes. In jeder Hinsicht verhalte er sich gleichermaßen respektvoll gegenüber den Lehren des Geringen und des Höchsten [Fahrzeugs].
(90) [Zuhörer,] die ein Gefäß für die umfassendere Lehre sind, führe er nicht in die geringere Lehre ein, noch vernachlässige er ihre Praxis, noch blende er sie mit [Rezitationen von] Sūtras und Mantras.
(91) Ein weggeworfenes Zahnholz oder ausgespuckten Speichel soll er verdecken. Verachtenswert ist das Urinieren und dergleichen in Gewässern oder auf Böden, die genutzt werden.
(92) Er esse nicht laut, mit vollem oder mit offenem Mund. Er sitze nicht mit ausgestreckten Beinen und reibe nicht die Hände aneinander.
(93) [Der Mönch] reise, sitze und übernachte nicht allein mit der Frau eines anderen. Er beobachte und erkundige sich, um alles zu vermeiden, was das Vertrauen der Menschen erschüttert.
(94) Er zeige nicht mit dem Finger auf etwas, sondern stets respektvoll mit der ganzen rechten Hand; so weise er auch den Weg.
(95) Er winke nicht heftig mit den Armen, sondern mache dezent und mit einem Geräusch [auf sich aufmerksam], indem er etwa mit den Fingern schnippt; sonst wäre er undiszipliniert.
(96) So wie sich der Meister sich zum Eingang in das Nirvāṇa niederlegte, möge er sich in der bevorzugten Richtung schlafen legen, achtsam und vor dem Einschlafen mit dem festen Entschluss, am Morgen zeitig aufzustehen.
(97) Unzählig sind die Übungen, die für die Bodhisattvas gelehrt wurden; von diesen soll er aber unbedingt zunächst die Praktiken zur Reinigung des Geistes üben.
(98) Drei Mal am Tag und drei Mal zur Nacht soll er die „Drei Anhäufungen“ rezitieren.20 Damit tilgt er die restlichen Übertretungen, indem er sich auf die Sieger und auf das Streben nach dem Erwachen stützt.
(99) In welcher Lebenslage er sich auch befinden mag, sei es aus eigenem [Antrieb] oder durch andere, stets möge er sorgsam nach jenen Regeln handeln, die für die jeweilige Situation gelehrt wurden.
(100) Denn es gibt wahrlich nichts, das die Nachkommen der Sieger nicht üben müssten. Und für denjenigen, der in solcher Lebenskunst erfahren ist, gibt es nichts, das nicht verdienstvoll sein könnte.
(101) Er möge ausschließlich so handeln, dass es direkt oder indirekt dem Wohl der Wesen zukommt; allein zum Wohl der Wesen möge er alles dem Erwachen widmen.
(102) Niemals, auch nicht um den Preis seines Lebens, gebe er jenen geistigen Freund auf, der mit den Inhalten des Großen Fahrzeugs vertraut ist und die Übungsregeln eines Bodhisattvas befolgt.
(103) Aus dem „Erlösungsweg des Sambhava“ [des Gaṇðavyūhasūtra] soll er lernen, wie man sich dem Lehrer gegenüber verhält. Diese [hier beschriebenen] und weitere von dem Buddha verkündeten Lehren möge er durch Lesen der Sūtras kennenlernen.
(104) In den Sūtras finden sich die Übungsregeln; deshalb möge er die Sūtras lesen. Zuerst studiere er das „Sūtra des Ākāśagarbha“.21
(105) Ebenso soll er unbedingt immer wieder das „Kompendium der Übungsregeln“22 einsehen, weil darin all das ausführlich erklärt wird, was stets zu üben ist.
(106) Alternativ kann er zunächst das zusammengefasste „Kompendium der Sūtras“ studieren oder das von dem erhabenen Nāgārjuna verfasste zweite [Werk gleichen Namens].23
(107) Er soll das tun, was in diesen Werken nicht untersagt wird; denn um den Geist der Menschen [vor dem Verlust ihres Vertrauens etc.] zu beschützen, muss er die Übungsregeln kennen und korrekt anwenden.
(108) Genau dieses ist, kurz gefasst, das Wesen der Übung der Wachsamkeit: Immer wieder sind die Zustände von Körper und Geist zu überprüfen.
(109) Mit dem Leben selbst will ich all dieses lernen; denn was nützt das Aussprechen bloßer Worte? Ist etwa den Kranken durch bloßes Lesen von medizinischen Abhandlungen geholfen?
6. Geduld
(1) All die guten Werke, die man sogar über Tausende von Zeitaltern vollbracht hat, wie Wohltätigkeit, Verehrung der Sugatas und dergleichen, kann durch einen einzigen [Ausbruch der] Wut wieder zunichte gemacht werden.24
(2) Kein Übel gleicht dem Hass. Keine Askese gleicht der Geduld. Darum möge man mit ganzer Kraft und auf vielfältige Weise Geduld üben.
(3) Wenn der Stachel des Hasses das Herz erfasst hat, erfährt das Denken keine Ruhe, erlangt weder Freude noch Glück, und der Mensch findet keinen Schlaf und keine Festigkeit.
(4) Selbst jene, die von ihrem Herrn abhängig sind, weil er sie mit Gütern und Ehrungen begünstigt, wenden sich gegen ihn und trachten ihm nach dem Leben, wenn er voller Hass ist.
(5) Er bereitet seinen Freunden Sorge. Er will die Menschen mit Geschenken für sich einnehmen, aber man dankt es ihm nicht. Kurz, es gibt niemanden, der im Zustand von Zorn glücklich ist.
(6) Zorn ist der Feind, der diese und andere Leiden bewirkt. Wer entschlossen den Zorn vernichtet, der ist hier und in der anderen Welt glücklich.
(7) Wenn der Zorn erst seine Nahrung gefunden hat in der Unzufriedenheit, die aufkommt, sobald das geschieht, was ich nicht will, oder das verhindert wird, was ich will, dann wird er stark und richtet mich zugrunde.
(8) Deshalb werde ich diesem Feind die Nahrung entziehen, denn dieser Gegner hat keine andere Aufgabe, als mir zu schaden.
(9) Was auch [an Widrigkeiten] kommen mag: Meine Heiterkeit werde ich mir nicht erschüttern lassen. Denn durch die Unzufriedenheit werde ich das Gewünschte auch nicht erreichen; die heilsamen Anlagen aber gehen verloren.
(10) Wenn man eine Sache verändern kann, warum darüber unzufrieden sein? Und wenn man daran nichts ändern kann, zu was nützt dann die Unzufriedenheit?
(11) Widerfährt es uns selbst oder jenen, die wir lieben, sind wir unzufrieden über Leid, Demütigung, Beschimpfung oder Verleumdung. Widerfährt es unseren Feinden, verhält es sich umgekehrt.
(12) Die Ursachen für Glück entstehen nur manchmal; die Ursachen für Leiden dagegen überaus häufig. Doch ohne Leiden gibt es keine Entsagung; daher bleibe fest, mein Geist.
(13) Die Anhänger der [Göttin] Durgā und die Bewohner von Karṇāta ertragen die Schmerzen des Brennens, Schneidens und dergleichen ohne Nutzen; warum sollte ich da verzagen, wenn es um die Befreiung geht?
(14) Es gibt nichts, das durch Gewöhnung nicht leichter würde. Lerne daher durch die Gewöhnung an geringfügiges Leid, auch großes Leid zu ertragen.
(15) Warum erkennst du nicht [den Nutzen] der bedeutungslosen Leiden, die zum Beispiel durch Schlangen und Wespen, Hunger- und Durstgefühl oder einen Hautausschlag entstehen?
(16) Ich werde bei Hitze und Kälte, Regen und Wind, Krankheit, Gefangenschaft und Schlägen nicht wehleidig sein, denn sonst nimmt das Leid noch zu.
(17) Einige werden zur Tapferkeit angetrieben, wenn sie ihr eigenes Blut sehen; andere fallen schon in Ohnmacht, wenn sie das Blut eines anderen sehen.
(18) Dieser [Unterschied] kommt zustande, je nachdem, ob das Gemüt fest oder ängstlich ist. Deshalb werde ich mich, ungeachtet des Schmerzes, von den Leiden nicht überwältigen lassen.
(19) Selbst wenn Leiden entsteht, möge der Weise die Klarheit des Gemüts nicht [durch den Ärger] trüben. Denn er kämpft mit den Leidenschaften, und in einem Kampf gibt es viele Verletzungen.
(20) Jene sind die siegreichen Helden, die alles Leiden für gering halten und den Hass und die übrigen [Leidenschaften] bekämpfen. Die anderen töten doch nur Leichen.
(21) Zudem hat das Leiden weitere Vorzüge: Die Ernüchterung vertreibt den Hochmut, und mit den Wesen im Kreislauf entsteht Mitgefühl. Vor schlechten Taten scheut man sich, und an heilsamen Handlungen entsteht Freude.
(22) Ich bin ja auch nicht zornig auf die Galle und andere [Körpersäfte], obgleich sie große Leiden verursachen. Warum bin ich dann zornig auf jene [Ärgernisse], die mit einem Geist versehen sind? Auch sie alle werden von Bedingungen bewegt.
(23) So wie beispielsweise eine Krankheit ohne Absicht [der Körpersäfte] entsteht, so steigen auch die quälenden Emotionen mit voller Wucht ohne Absicht auf.
(24) Die Menschen denken nicht zuerst: „Ich will wütend werden!“. Sie werden ganz einfach wütend. Ebenso kommt auch der Zorn auf, ohne dass er gedacht hat: „Ich will entstehen.“
(25) Sämtliche Schuld und all die vielfältigen unmoralischen Handlungen entstehen kraft der Bedingungen. Es gibt nichts, das unabhängig wäre.
(26) Die Schar der Bedingungen wiederum denkt nicht: „Ich will [jene Wirkung] hervorbringen.“ Und die von ihnen hervorgebrachte [Wirkung] denkt nicht: „Ich wurde hervorgebracht.“
(27) Was [von einigen Schulen] als „Urstoff“ postuliert oder als [beständiges] „Selbst“ angenommen wird, das entsteht nicht mit der Absicht: „Ich will entstehen.“
(28) Denn wie könnte ein [beständiges Selbst] zu entstehen beabsichtigen, wenn es noch gar nicht entstanden ist und folglich noch gar nicht existiert? Und weil es immerzu in Aktivität wäre durch die Wahrnehmung der [von dem Urstoff geschaffenen] Objekte, könnte es auch niemals aufhören zu existieren.
(29) Ein beständiges Selbst wäre offensichtlich so untätig wie der Raum. Wie sollte etwas tätig sein, das sich nicht verändert, selbst wenn es auf andere Bedingungen trifft?
(30) Was würde denn die Tätigkeit [für das Selbst] bewirken, wenn es während der Tätigkeit bliebe, wie es vorher war? Welche Verbindung zwischen [Selbst und Tätigkeit] könnte bestehen, die es rechtfertigt zu sagen, dass diese die Tätigkeit von jenem ist?
(31) So geschieht alles aufgrund von anderem; und auch das [andere] ist seinerseits abhängig und nicht unbhängig. In diesem Wissen entsteht kein Zorn gegenüber all den Dingen, gleichen sie doch einem Zauberwerk.
(32) Nun fragt ihr: „Aber mit welchen [Gegenmitteln] soll man dann welchem [Zorn] entgegentreten? Ein Abwenden wäre nicht möglich.“ ‒ [Wir sagen:] Es besteht kein Fehler in unserer Position, weil eben in Abhängigkeit von jenen [Gegenmitteln] die Leiden zu Ende gehen.
(33) Daher bleibe man gelassen, wenn man gesehen hat, dass jemand Unrecht tut – sei er nun Freund oder Feind – in dem Bewusstsein, dass dies aufgrund der Bedingungen geschieht.
(34) Wenn diese Wesen ihre Ziele nach ihren Wünschen erreichten, würde niemand Leiden erfahren, denn niemand will leiden.
(35) Aus Unbedachtheit fügen sich die Menschen selbst mit Dornen und dergleichen Schaden zu. Geplagt von Zorn oder Begehrlichkeit, um etwa eine Frau oder anderes [Begehrtes] zu bekommen, hören sie sogar auf zu essen oder tun sich anderes Leid an.
(36) Einige erhängen sich oder springen in einen Abgrund, nehmen Gift oder essen Unbekömmliches, begehen Verbrechen. So schaden sie sich selbst.
(37) Wie könnte man erwarten, dass sie den Körper anderer nicht verletzen, wenn sie unter der Macht der Leidenschaften sogar ihr geliebtes Selbst töten?
(38) Wie kann man mit jenen [Verblendeten], die unter dem Einfluss der Leidenschaften sogar sich selbst umbringen oder auf andere Art [schaden], nicht nur kein Mitleid empfinden, sondern auch noch zornig auf sie sein?
(39) Wenn es die Natur der Unreifen ist, rücksichtslos gegen andere zu sein, dann ist es nicht angebracht, ihnen zu zürnen. Das wäre so, als würde man dem Feuer sein brennendes Wesen übelnehmen.
(40) Wenn aber dieser Fehler zufälliger Natur ist und die Lebewesen in ihrem Wesen sanftmütig sind, dann ist der Zorn gegen sie ebenso unberechtigt. Das wäre so, als würde man es der Luft anlasten, dass sie von beißendem Rauch erfüllt ist.
(41) Wer meint, den eigentlichen [schädigenden] Gegenstand, etwa den Stock, unbeachtet zu lassen und den Zorn vielmehr auf den zu richten, der damit schlägt, der müsste eigentlich dem Hass zürnen, da dieser [den Schädiger] bewegt.
(42) In der Vergangenheit habe ich den Lebewesen den gleichen Schaden zugefügt. Daher geschieht es mir wohl recht, dass sie mir nun diese Verletzung zufügen, habe ich mich doch gegen sie vergangen.
(43) Beide, seine Waffe und mein Körper, sind Ursachen des Schmerzes. Er hat die Waffe, ich habe den Körper eingebracht. Worauf soll ich meinen Zorn richten?
(44) Diese quälende Eiterbeule in menschlicher Gestalt, die keinen Stoß verträgt, habe ich selbst ergriffen, von Verlangen geblendet. Auf wen soll ich wütend sein, wenn sie schmerzt?
(45) Das Leiden will ich nicht, töricht aber verlange ich nach der Ursache des Leidens. Wie kann ich auf anderes erbost sein, wenn ich für mein Leiden selbst verantwortlich bin?
(46) Wie zum Beispiel die Höllenwächter oder der Schwertblätterwald ist auch dieses [gegenwärtige Leiden] von meinen eigenen Taten verursacht. Worauf soll ich also wütend sein?
(47) Bewegt durch meine Taten, werden sie zu meinen Schädigern. Wenn sie dadurch in die Hölle gehen, bin nicht ich es, der sie vernichtet?
(48) Dank ihnen tilge ich große Schuld, wenn ich Geduld übe. Um meinetwillen aber geraten sie in die Höllen mit ihren lang andauernden Qualen.
(49) So bin ich es, der ihnen schadet, und sie sind es, die mir nutzen. Warum verdrehst du die Tatsachen, böses Herz, und bist zornig?
(50) Falls ich [dennoch] nicht zur Hölle fahre, so deshalb, weil ich die Tugenden des Herzens pflege. Wenn ich mich so selbst rette, was hilft es ihnen?
(51) Nun könnte ich [ihr Unrecht] mit Schaden erwidern. Aber davon werden sie nicht gerettet, meine ethische Lebensweise scheitert, und meine Fähigkeit des Ertragens zerbricht.
(52) Weil das Denken körperlos ist, kann es nirgends und von niemandem getroffen werden. Aber da man am Körper hängt, fühlt man sich von den Schmerzen, die dem Körper zugefügt werden, [auch geistig] verletzt.
(53) Herabwürdigung, harsche Rede, Verleumdung, diese Worte treffen den Körper nicht. Warum erbost du dich, mein Geist?
(54) Von der Abneigung der anderen gegen mich werde ich weder in diesem noch in einem anderen Leben aufgefressen; warum also stört sie mich?
(55) Falls die Abneigung mir unerwünscht ist, weil sie meinen Erfolg verhindert: Meinen Erfolg muss ich hier zurücklassen, doch meine Übeltaten werden mir dauerhaft bleiben.
(56) Besser wäre es, heute noch zu sterben, als lange ein falsches Leben zu führen. Denn auch wenn ich lange gelebt haben sollte, bleibt das Leiden des Todes dann doch das gleiche.
(57) Einer wacht auf, nachdem er im Traum das Glück von hundert Jahren erlebt hat; der andere wacht auf, nachdem er nur das Glück eines Augenblicks gekostet hat.
(58) Doch bei beiden kehrt das Glück nicht zurück, wenn sie aufgewacht sind. Genauso gleich sind in der Stunde des Todes jene, die ein langes Leben hatten, und jene, die nur ein kurzes Leben gelebt haben.
(59) Wenn ich auch viele Güter erworben und über lange Zeit das Glück genossen habe: Nackt und mit leeren Händen werde ich fortgehen, wie von Räubern ausgeplündert.
(60) „Aber indem ich von meinem Besitz lebe, werde ich das Böse tilgen und das Verdienstvolle vermehren!“ ‒ Doch wird nicht gerade das Verdienstvolle getilgt und das Böse vermehrt, weil der Zorn um des Besitzes willen aufkommt?
(61) Wenn aber eben jenes Ziel, für das ich lebe, verfällt, welchen Sinn hat dann ein Leben, von dem nichts als Übel ausgeht?
(62) „Wer [mir] Schlechtes nachsagt, der beeinträchtigt damit [mein Wirken für] die Wesen, deshalb bin ich auf ihn zornig.“ ‒ Aber warum richtet sich dein Zorn dann nicht genauso gegen den, der andere verleumdet?
(63) Du tolerierst den Kritiker, weil sein ablehnendes Urteil von anderem bedingt ist.25 Warum bist du dann nicht ebenso nachsichtig gegenüber [deinem] Verleumder, weil sein Verhalten doch durch die Leidenschaften bedingt ist?
(64) Selbst auf jene, die Bildnisse [des Buddhas], Reliquienschreine oder die edle Lehre schmähen oder zerstören, ist mein Hass ungerechtfertigt, denn die Buddhas und die anderen [Objekte der Verehrung] leiden nicht darunter.
(65) Auch den Zorn auf jene muss man abwenden, die Lehrer, Verwandte und geliebte Menschen verletzen, indem man auf die zuvor beschriebene Weise erkennt, dass ihr Verhalten aus Bedingungen hervorgeht.
(66) Sowohl bewusste [Lebewesen] als auch unbewusste [Dinge] bereiten den Wesen Leiden. Warum richtet sich dein Zorn allein auf jene mit Bewusstsein? Ertrage daher die zugefügten Verletzungen mit Geduld!
(67) Die einen verhalten sich aus Verblendung schlecht, die anderen, ebenfalls verblendet, werden zornig. Wen von ihnen nennen wir den Unschuldigen und wen den Schuldigen?
(68) Warum nur hast du früher solche Taten begangen, dass dich die anderen nun verletzen? Wenn all das von jenen Taten bedingt ist, warum feinde ich sie an?
(69) In diesem Wissen will ich mich mit ganzer Kraft um gute Werke bemühen, damit alle füreinander eine liebevolle Haltung hegen mögen.
(70) Es ist wie bei einem Hausbrand: Wenn das Feuer schon auf das Nachbarhaus übergesprungen ist, entzieht man dem Feuer das Stroh und andere entzündliche Stoffe, an denen es sich entfacht, und schafft sie fort.
(71) Genau so muss man jenes [Ärgernis], an dem sich das Feuer des Hasses entzündet, weil das Denken daran festhält, auf der Stelle loslassen, aus Furcht, das Verdienst könnte verbrannt werden.
(72) Ist es denn ein Unglück, wenn man einem zum Tode Verurteilten lediglich die Hand abhackt und ihn dann freilässt? Ist es denn ein Unglück, wenn man durch die menschlichen Leiden von der Hölle verschont wird?
(73) Wenn ich schon jetzt ein geringes Leiden nicht ertragen kann, warum bekämpfe ich dann nicht den Zorn, die Ursache für die Höllenqualen?
(74) Tausendfach habe ich für das Sinnesglück Verbrennungen und andere Qualen in den Höllen erlitten. Dadurch habe ich weder mein eigenes Glück noch das der anderen erreicht.
(75) Man kann sich nur freuen über das Leiden hier, mit dem man Schaden von der Welt fernhält, denn dieses ist weniger schlimm, und es verhilft zum Erreichen großer Ziele.
(76) Wenn andere das Glück des Entzückens darin finden, dass sie einen guten Menschen loben, warum freust du dich nicht mit ihnen, mein Geist, indem auch du ihm Lob spendest?
(77) Diese Wonne der Freude ist eine Glücksquelle ohne Schande. Auch die Tugendhaften haben nichts dagegen einzuwenden, und sie ist das beste Mittel, um andere für sich zu gewinnen.
(78) „Aber der andere wird ja [durch mein Lob] auch glücklich!“ ‒ Wenn dir deshalb dein Glück nicht gefällt, dann müsstest du auch [jede andere Anerkennung] wie das Geben des Lohns und dergleichen unterlassen, und damit zerstörst du gewiss dein sichtbares und unsichtbares [Glück in diesem und in zukünftigen Leben].
(79) Wenn deine eigenen Vorzüge gelobt werden, hast du es gern, dass es andere freut. Doch wenn die Vorzüge der anderen gelobt werden, gefällt dir selbst deine eigene Freude daran nicht.
(80) Motiviert von dem Wunsch nach dem Glück aller Lebewesen hast du das Streben nach dem Erwachen entwickelt. Warum bist du dann erbost, wenn ein Wesen von sich aus Glück findet?
(81) Wie du sagst, wünschst du den Wesen jenes Erwachen, durch das sie verehrungswürdig werden in den drei Welten. Aber warum quält es dich dann, wenn du vernimmst, dass jemandem nur eine dürftige Anerkennung gezollt wird?
(82) Wenn etwa ein Schützling, dessen Ernährer du bist und für dessen Unterhalt du eigentlich selbst aufkommen müsstest, seinen Lebensunterhalt von einem Verwandten erhält, empörst du dich dann und freust dich nicht mit?
(83) Was für einer ist der, welcher den Wesen das Erwachen wünscht, ihnen aber das [geringe Glück von etwas Reichtum oder Anerkennung] nicht gönnt? Wie kann in einem das Streben nach dem Erwachen bestehen, der sich über den Glückserfolg des anderen ärgert?
(84) Denn ganz gleich, ob er es selbst erhält oder ob es im Hause des Gönners bleibt, in jedem Fall bekommst du es nicht. Was also kümmert es dich, ob es ihm gegeben wurde oder nicht?
(85) Warum wirfst du deine Vorzüge, etwa deine Verdienste oder das Vertrauen, das du genießt, fort? Sage, warum ereiferst du dich nicht darüber, dass du nicht das kultivierst, was dir Glück bringt?
(86) Nicht genug, dass du dich nicht über dich selbst beklagst angesichts der Missetaten, die du begangen hast. Nun willst du auch noch mit den anderen in Konkurrenz treten, die Gutes getan haben?
(87) Wenn deinem Feind auch Unangenehmes widerfährt, warum befriedigt es dich? Allein durch deine [missgünstige] Absicht kommt die Ursache für seinen Schaden ja nicht zustande.
(88) Und wenn sein Leiden tatsächlich durch deine Absicht entstünde, aus welchem Grund könntest du dich darüber freuen? „Weil ich dann Genugtuung empfinde.“ ‒ Was könnte wohl zerstörerischer sein?
(89) Es ist ein schrecklicher, scharfer Angelhaken, den die Leidenschaften als Fischer ausgeworfen haben. Von ihm eingefangen, werde ich dann unweigerlich in den Höllenkesseln von den Höllenwächtern gegart werden.
(90) Die Ehre von Lob und Ruhm bringt mir weder Verdienst noch Lebenszeit, weder Stärke noch Gesundheit und auch kein körperliches Wohlbehagen.
(91) Welcher Vorteil könnte für mich in diesen Dingen liegen, wenn ich ohnehin um meine Vorzüge weiß? Wer nur Spaß wünscht, soll sich dem Glücksspiel, dem Wein und Ähnlichem widmen.
(92) Für den Ruhm geben sie ihr Vermögen hin, bringen sich gar selbst um. Aber zu was sind diese gesprochenen Laute nutze? Wenn man tot ist, wen beglücken sie dann?
(93) Wenn ihr Sandhaus einstürzt, weinen die Kinder aus Verzweiflung. Ebenso kindisch verhält sich mein Geist, wenn Lob und Ruhm vergehen.
(94) Nun hat der Klang [der Lobesworte] keinen Geist und also auch unmöglich die Absicht, mich zu loben. Zu wissen, dass sich ein anderer an mir erfreut, das muss wohl der Grund meiner Freude sein.
(95) Doch was habe ich davon, dass ein anderer sich freut, sei es über mich oder einen anderen? Das Glück dieser Freude gehört ihm allein; ich bekomme davon nicht den geringsten Anteil.
(96) Wenn mich aber sein Glück froh macht, dann sollte ich es bei allen anderen ebenso empfinden. Warum kann ich über einige, die sich mit anderen freuen, nicht froh sein?26
(97) Also entsteht mein Gefallen [am Lob] mit dem Gedanken, dass ich es bin, der gelobt wurde. Das ist aber ebenso unlogisch und daher nichts als kindisches Benehmen.
(98) Lob und dergleichen lenkt mich ab und untergräbt die Ernüchterung [über den Daseinskreislauf ]. Es macht mich neidisch auf jene, die gute Eigenschaften besitzen, und zerstörerisch gegenüber jenen, die Wohlergehen erlangt haben.
(99) Bewahren mich also jene, die sich gegen mich stellen, um Lob und anderes für mich zu vereiteln, nicht [in Wahrheit] davor, mich ins Unheil zu stürzen?
(100) Als jemand, der nach Befreiung strebt, brauche ich keine Fesselung durch Besitz und Ehre. Warum sollte ich jene hassen, die mich von dieser Fessel befreien?
(101) Gleich dem Segen des Buddhas sind sie für mich, der begierig ist, in [das Haus der] Leiden einzudringen, zur Sperrtür geworden. Wie könnte ich sie hassen?
(102) „Jener Mensch hindert mich an meinen Verdiensten!“ Auch solcher Zorn ist nicht angebracht, denn es gibt keine bessere Askese als die Geduld. Warum widme ich mich ihr dann nicht?
(103) Wenn ich aber aus eigenem Unvermögen keine Geduld mit ihm übe, dann schaffe nur ich allein das Hindernis dort, wo sich eine Möglichkeit für Verdienst bietet.
(104) [Denn] jenes Ding, durch das eine Sache zustande kommt, wenn es existiert, und nicht zustande kommt, wenn es nicht existiert, wird ja Ursache genannt. Wie kann man es ein Hindernis nennen?
(105) Ein Bettler, der zur rechten Zeit am Ort ist, behindert gewiss nicht die Freigebigkeit. Und [den Bettelmönch], der den Weg in die Hauslosigkeit weist, kann man nicht als ein Hindernis für diesen Gang bezeichnen.
(106) In der Welt sind Bettelnde häufig anzutreffen, doch nur selten Schädiger. Denn niemand wird mir Schaden zufügen, wenn ich ihm nicht Schaden zugefügt habe.
(107) Deshalb will ich den Feind freudig willkommen heißen wie einen Schatz, der sich im Haus einfindet, ohne mühevoll erworben zu sein, denn er hilft mir auf dem Weg zum Erwachen.
(108) Da sie also von ihm wie von mir hervorgebracht wurde, ist es angemessen, die [heilsame] Frucht der Geduld zuerst ihm zukommen zu lassen, denn hierbei ist er die Ursache für meine Geduld.
(109) „Aber der Feind hat gar nicht die Absicht, meine Geduld zu fördern. Also muss ich ihn auch nicht würdigen.“ ‒ Aber warum verehrst du dann die edle Lehre, die als [absichtslose] Ursache den Fortschritt [auf dem Pfad] ermöglicht?
(110) „Doch der Feind hat die Absicht, mir zu schaden. Deshalb kann ich ihm keine Achtung zollen.“ ‒ Wie kann sich sonst wohl meine Geduld entfalten? Etwa dann, wenn er sich wie ein Arzt um mein Wohl sorgt?
(111) Die Geduld enstaht nur in der Folge seiner bösen Absicht. Also ist [der Feind] die wahre Ursache der Geduld. Daher ist er der gleichen Hochachtung würdig wie die edle Lehre.
(112) Aus diesem Grund hat der Weise gelehrt, dass die Felder [auf denen die Verdienste erworben werden,] die fühlenden Wesen und die Siegreichen [Buddhas] sind. Viele haben sie erfreut und dadurch die höchsten Reichtümer erlangt.
(113) Wenn man also durch die Wesen wie durch die Sieger gleichermaßen die Eigenschaften eines Buddhas erlangt, ist es dann gerecht, dass man die Wesen nicht ebenso hochschätzt wie die Buddhas?
(114) Sie sind gleich ‒ wenn auch nicht von der Größe ihrer Intention, so doch von ihrer Wirkung her. Insofern haben auch die Wesen ihre Qualitäten, und aus eben diesem Grund sind sie gleichwertig [mit den Buddhas].
(115) Dass einem Menschen mit liebevoller Haltung Anerkennung zuteil wird, macht den Wert der Lebewesen aus. Dass aus dem Vertrauen in die Buddhas Verdienst entsteht, macht den Wert der Buddhas aus.
(116) Nur insofern, als sie ihren Anteil daran haben, dass jemand die Eigenschaften eines Buddhas erreicht, setzt man die Wesen mit den Siegern gleich. Aber niemand kommt den Buddhas gleich, den unendlichen Ozeanen von Tugenden.
(117) Wenn nur ein Bruchteil der Vorzüge jener, die ein wahres Füllhorn der Essenz aller Tugenden sind, in irgendeinem [dieser Wesen] zum Vorschein käme, wäre selbst die ganze Dreiwelt27 als Opfergabe zu seiner Verehrung nicht genug.
(118) Doch weil sie am Entstehen der hervorragenden Buddha-Eigenschaften teilhaben, ist es gerecht, die Lebewesen diesem Anteil gemäß zu verehren.
(119) Und mit welcher Dankesgabe außer der Liebe zu ihnen könnten wir den Wesen, diesen wahren Verwandten, den unermesslichen Nutzen erwidern, den sie für uns bewirken?
(120) Durch das Gute, das man jenen tut, für die sie ihren Körper hingegeben und freiwillig in die Avīci-Hölle gegangen sind, wird die Gegenleistung erbracht. Daher soll man sich gegenüber allen, auch den größten Schädigern, in jeder Hinsicht wohlwollend verhalten.
(121) Wie kann ich Verblendeter nur hochmütig sein gegen jene, zu deren Wohl selbst meine Meister nicht einmal auf sich selbst Rücksicht nehmen? Wie könnte ich nicht ihr wahrer Diener sein?
(122) Wenn ich jene beglücke, deren Glück die Buddhas erfreut, erfreue ich damit alle Buddhas; wenn ich jenen schade, deren Leiden die Buddhas besorgt, verletze ich damit alle Buddhas.
(123) So wenig jemand, dessen ganzer Körper Feuer gefangen hat, mit irgendwelchen Sinnesfreuden erheitert werden kann, so wenig gibt es ein Mittel, um die Mitleidsvollen zu erfreuen, wenn man die Lebewesen schädigt.
(124) Daher will ich heute das Unrecht bekennen, mit dem ich ihnen, die von großem Mitgefühl erfüllt sind, Kummer verursacht habe, indem ich den Lebewesen Leid zufügte. Mögen mir die Weisen alles vergeben, womit ich ihnen Unbehagen bereitet habe.
(125) Um den Tathāgatas Freude zu bereiten, will ich mich von jetzt an ganz und gar zum Diener der Welt machen, selbst wenn Heerscharen von Lebewesen mich mit ihren Fußsohlen auf meinem Kopf erdrücken oder gar töten wollten. Mögen die Beschützer der Welt sich an meinem Tun erfreuen!
(126) Zweifellos haben doch sie, deren Wesen von Mitleid erfüllt ist, die ganze Welt der Lebewesen zu ihrem Selbst gemacht. Und werden folglich nicht sie selbst in der Gestalt der Lebewesen sichtbar? Warum also zolle ich meinen Respekt nicht gerade diesen Lebewesen, deren Selbst die Beschützer sind?
(127) Dieses allein ist das Mittel, um die Vollendeten zu erfreuen. Dieses allein ist das Mittel, um das eigene Wohl zu verwirklichen. Dieses allein vernichtet das Leiden der Welt. Stets will ich nur dieses tun.
(128) Es mag zum Beispiel sein, dass ein einziger Mann des Königs ein großes Volk tyrannisiert, die Leute ihm aber aus Weitsicht nichts antun, obwohl sie dazu fähig wären,
(129) weil er nicht allein ist, sondern die Macht des Königs hinter sich hat. Ebenso sollte man auch keinen Schwachen, der sich schuldig gemacht hat, gering schätzen, (130) denn seine mächtigen Freunde sind die Höllenwächter und die Mitleidsvollen. Deshalb soll man die Lebewesen mit Zuneigung für sich gewinnen, wie das Volk seinen reizbaren Herrscher. (131) Könnte selbst ein erboster Herrscher die Höllenqualen bewirken, die man erleben wird, weil man den Wesen Missbehagen bereitet hat?
(132) Und selbst ein zufriedener Herrscher vermag unmöglich, die Buddhaschaft zu gewähren, die man erlangen wird, weil man den Wesen wohlgesonnen ist.
(133) Doch lassen wir ruhig die zukünftige Buddhaschaft, die sich daraus ergibt, dass wir uns den Wesen zuwenden, außer Acht. Siehst du nicht, wie sich schon in diesem Leben Erfolg, guter Ruf und Wohlbehagen einstellen?
(134) Schon im Kreislauf der Existenzen lebt der Geduldige ein langes Leben mit Schönheit, Gesundheit und gutem Ruf und erlangt die Fülle des Glücks eines Weltenherrschers.
7. Tatkraft
(1) Wer sich so in Geduld geübt hat, möge sich nun der Tatkraft widmen, denn in der Tatkraft liegt das Erwachen. Wie es keine Bewegung ohne Wind gibt, so auch kein Verdienst ohne Tatkraft.
(2) Was ist Tatkraft? Es ist die Begeisterung für das Heilsame. Ihre Gegenteile sollen erläutert werden: die Trägheit, das Hängen am Schlechten und das mangelnde Selbstvertrauen aus Entmutigung.
(3) Aus mangelnder Ernüchterung über das Leiden im Daseinskreislauf entsteht durch den Genuss des süßen Geschmacks von Müßiggang und aus dem Verlangen nach Schlaf und Anlehnen die Trägheit.
(4) Deinen Jägern, den Leidenschaften, bist du ins Fangnetz der Geburten gegangen. Erkennst du jetzt noch nicht, dass du im Rachen des Todesherrn steckst?
(5) Siehst du nicht, wie er deine eigenen Leute einen nach dem anderen tötet? Und doch gibst du dich dem Schlaf hin, wie der Büffel auf dem Schlachthof.
(6) Wie kannst du dich am Essen erfreuen, während gerade der Herr des Todes seinen Blick auf dich richtet, nachdem er zuvor alle Fluchtwege versperrt hat? Wie kannst du dich dem Schlaf hingeben, wie der Lust?
(7) Da der Tod schnell kommen wird, wie willst du bis dahin das Rüstzeug [durch heilsame Werke] zusammengetragen haben? Und selbst wenn du dann, zur falschen Zeit, die Trägheit aufgibst, was kannst du noch tun?28
(8) „Dieses habe ich noch nicht gemacht, jenes angefangen, das ist halb liegen geblieben. Und nun ist der Herr des Todes so plötzlich gekommen. Wehe mir! Ich bin verloren!“ So wirst du denken (9) und in die tränenüberströmten Gesichter der Verwandten schauen, die nun jede Hoffnung verloren haben. Du blickst in ihre roten, von der Wucht des Kummers geschwollenen Augen und gleichzeitig in die Fratzen der Todesboten.
(10) Entsetzt von der Pein der Erinnerung an deine Übeltaten und von dem Gebrüll aus den Höllen in deinem Ohr, besudelst du dich mit Kot und verlierst den Verstand. Was willst du dann tun?
(11) Wenn du dich schon vor diesem Leben fürchten musst wie ein [im Becken] zappelnder Lebendfisch, wie sehr erst, du Übeltäter, vor den schrecklichen Leiden in den Höllen?
(12) Wie kannst du so sorglos verharren, nachdem du die Taten begangen hast, die zur Hölle führen, wo dir, zartes Kind, die Schmerzen durch die Berührung mit den siedend heißen Wassern zusetzen werden?29
(13) Du bist ein Untätiger, der aber nach der Frucht verlangt, ein Weichling, der doch vielen Verletzungen ausgesetzt ist, ein vom Tode Eingefangener, der sich für gottgleich hält. Ach, das Leiden wird dich überwältigen!
(14) Mit dem Boot der menschlichen Existenz überquere den großen Strom des Leidens! Schlafe nicht, Verblendeter, wenn jetzt die rechte Zeit gekommen ist! Denn dieses Boot ist schwer wieder zu erlangen.
(15) Wie kannst du nur Freude finden an Belustigungen und anderen Ablenkungen, die Ursachen für Leiden sind, während du die vorzügliche Freude an der edlen Lehre verwirfst, die endlose Freuden mit sich bringt?
(16) Lerne Selbstvertrauen, die Aufstellung des Heeres der [vier] Kräfte, die Hingabe an die Aufgabe, die Beherrschung des Selbst, das Gleichsetzen des Selbst mit den Anderen und das Austauschen des Selbst gegen die Anderen.
(17) „Wie sollte ich wohl das Erwachen erreichen?“ ‒ So darfst du dich nicht entmutigen. Denn der Vollendete, der Verkünder der Wahrheit, hat diese wahren Worte gesprochen:
(18) „Auch jene, die einst Fliegen, Bremsen, Bienen oder Würmer waren, werden, falls sie die Kraft der Bemühung hervorbringen, das schwer zu erlangende, unübertroffene Erwachen verwirklichen.“
(19) Ich aber bin als Mensch geboren und daher in der Lage, Nutzen und Schaden zu erkennen. Wie sollte ich nicht das Erwachen verwirklichen, solange ich den Weg des Erwachens nicht aufgebe?30
(20) „Aber ich fürchte mich davor, meine Hände, Füße und dergleichen fortgeben zu müssen!“ ‒ Das ist nur meine Angst, weil ich aus Unwissenheit nicht beurteilen kann, was schwer und was leicht ist:
(21) In unzähligen Millionen Zeitaltern werde ich [im Daseinskreislauf ] viele Male verstümmelt, aufgespießt, verbrannt und zersägt werden, aber das Erwachen werde ich dadurch nicht erlangen.
(22) Dagegen ist die Mühsal, die ich erdulden muss, um das Erwachen zu verwirklichen, begrenzt, zu vergleichen mit dem Leiden durch einen chirurgischen Eingriff zur Behandlung einer schmerzhaften Krankheit, die den Körper befallen hat.
(23) Alle Ärzte greifen gewiss zu unangenehmen Heilverfahren. Um viele Leiden zu lindern, muss man daher geringe Übel ertragen.
(24) Solche [schmerzhaften] Therapien wie diese gewöhnlichen ordnet jedoch [der Buddha als] der beste Arzt nicht an. Vielmehr heilt er mit überaus sanften Methoden unzählige schwere Krankheiten.
(25) Zuerst hält der Meister dazu an, Gemüse und anderes zu geben. Daran gewöhnt, mag man später nach und nach sogar seinen eigenen Körper hingeben.
(26) Wer erst die Wahrnehmung hat, dass sein Körper wie Gemüse anzusehen ist, welche Mühe sollte es ihm dann bereiten, sogar den eigenen Leib oder Teile davon hinzugeben?
(27) Denn weil sie das Schlechte abgelegt haben, leidet [ihr Körper] nicht. Weil sie wissend sind, leidet ihr Geist nicht. Denn falsche Auffassungen schaden dem Geist, und schlechte Handlungen schaden dem Körper.
(28) Durch ihre Verdienste wird ihr Körper und durch ihr Wissen ihr Geist beglückt. Was also soll sie bedrücken, die Mitleidsvollen, die zum Wohle der anderen gar im Kreislauf verbleiben?
(29) Getragen von der Kraft des Strebens nach dem Erwachen tilgt [der Bodhisattva] die schlechten Taten der Vergangenheit und führt Meere von Verdiensten zusammen. Aus diesem Grund wird gesagt, dass er die Hörer [auf dem Weg zum Erwachen] übertrifft.31
(30) Welcher Vernünftige könnte sich entmutigen lassen, da er auf dem Streitwagen des Strebens nach dem Erwachen, das allen Kummer und alle Ermattung vertreibt, von Glücksmoment zu Glücksmoment voraneilt?
(31) Seine Armee zur Verwirklichung der Ziele der Lebewesen besteht aus Anstreben32, Festigkeit, Freude und Lassen. Das Anstreben [des Heilsamen] entwickle er durch die Furcht vor den Leiden und die Betrachtung der Vorzüge dieses [Strebens].33
(32) Indem man also ihre Gegenteile überwindet, bemühe man sich darum, die Tatkraft zu stärken ‒ mit Hilfe der Kräfte von Anstreben, Selbstbewusstsein, Freude, Lassen, Hingabe und Beherrschung des Selbst.
(33) Zahllose Fehler, meine eigenen und die der anderen, muss ich beseitigen, wobei sogar für jeden einzelnen ein Ozean von Zeitaltern gebraucht wird.
(34) Dabei kann ich nicht einmal mit einem Teil der Anstrengung aufwarten, die zur Überwindung eines einzigen Fehlers nötig wäre. Unermessliches Leiden steht mir bevor; muss mir da nicht das Herz zerspringen?
(35) Viele Tugenden gilt es zu erringen, meine eigenen und die anderer. Jede einzelne Tugend wird einen Ozean von Zeitaltern der Übung erfordern.
(36) Doch habe ich niemals auch nur einen Bruchteil dieser Tugenden geübt. Es ist bestürzend, wie ich diese so unglaublich schwer zu erlangende [menschliche] Geburt sinnlos vergeudet habe.
(37) Die Erhabenen habe ich nicht verehrt und das Glück großer Feste nicht gespendet. Verdienste gegenüber der Lehre habe ich nicht erwirkt und die Hoffnungen der Armen nicht erfüllt.
(38) Denen, die sich in Gefahr befinden, habe ich keinen Schutz gewährt. Den Bedrückten habe ich kein Glück bereitet. Nur der Mutter habe ich die Schmerzen des Leibes und andere Mühen bereitet, sonst nichts.
(39) Weil mir jetzt und in der Vergangenheit das Streben nach der Lehre fehlte, ist solches Unglück entstanden. Wer würde [mit dieser Erkenntnis] den Wunsch nach Verwirklichung der Lehre aufgeben?
(40) Der Weise hat gelehrt, dass das Anstreben die Basis jeder heilsamen [Entwicklung] ist. Dessen Wurzel ist das ständige Betrachten der Früchte, die daraus erwachsen.
(41) Vielfältige Formen von [körperlichem] Leiden und [geistiger] Bedrückung sowie Furcht und Trennung von Gewünschtem entstehen, weil man Unrecht tut.
(42) Wohin sich jener, der mit [freudiger] Absicht Heilsames tut, auch wenden mag, dort wird er wegen seiner Verdienste mit dem Gastgeschenk der Frucht geehrt werden.
(43) Wohin sich jener, der Böses tut, auch begeben mag, und sei es auf die Suche nach Glück, dort wird er wegen seiner Übeltaten durch die Waffen des Leidens niedergestreckt werden.
(44) Durch das Heilsame werden [die Lebewesen] zu Sugata-Kindern [im Sukhāvatī-Paradies], wo sie in Gegenwart des Siegers [Amitābha] verweilen. Zuvor ruhten sie in der Mitte weit geöffneter, duftender und kühler Lotosblumen. Die Nahrung der sanften Rede der Sieger nährte ihre schöne Form, und dann traten sie mit ihren prächtigen Körpern aus ihrer Lotosblüte hervor, die sich durch die Lichtstrahlen des Weisen öffnete.
(45) Durch seine vielen unheilsamen Taten stürzt [der Übeltäter] auf den glühend heißen Eisenboden [der Hölle]. Er wird von Schmerzen gequält, wenn die Schergen Yamas ihm die Haut gänzlich abziehen und auf seinen Körper das von Feuern geschmolzene, flüssige Kupfer gießen, um ihn dann mit brennenden Schwertern und Speeren zu stechen und in hunderte Fleischstücke zu zerteilen.
(46) Mit solchen [Überlegungen] soll man das Heilsame anstreben und hingebungsvoll üben. Hat man [sein Werk] begonnen, möge man nach dem Vorbild des Vajradhvaja[-Kapitels im Avataṃsakasūtra nun] das Selbstbewusstsein stärken.34
(47) Nachdem man zuerst die Voraussetzungen geprüft hat, soll man [ein Werk] beginnen oder unterlassen. Es ist nämlich besser, etwas nicht zu beginnen, als etwas Begonnenes abzubrechen.
(48) Auch in weiteren Geburten hat man sonst diese [schlechte] Angewohnheit. Das Unheilsame und das Leiden wachsen an. Mit dem nächsten Werk vergeudet man die Zeit für den Erfolg [des ersten], aber auch jenes [neue Werk] wird nicht vollendet.
(49) In Bezug auf drei Dinge möge man Selbstbewusstsein üben: in den Werken, gegenüber den Leidenschaften und in Bezug auf die Fähigkeiten. „Ich allein will es tun!“, das ist Selbstvertrauen in den Werken.
(50) Die Welt ist nicht einmal in der Lage, ihr eigenes Wohl zu erreichen, weil sie aufgrund ihrer Leidenschaften nicht Herr ihrer selbst ist. Die Wesen haben also nicht die gleichen Fähigkeiten wie ich. Deshalb bin ich es, der dieses Werk tun muss.
(51) Wie kann ich [untätig] bleiben, wenn andere die niederen Arbeiten verrichten, obwohl ich da bin? Verrichte ich [diese Arbeiten] aus Stolz nicht, wäre es besser, gar kein Selbstbewusstsein zu haben.
(52) Vor einer toten Schlange wird selbst die Krähe zum Garuða. Wenn ich schwach bin, wird mir selbst eine kleine Schwäche schaden.
(53) Kann sich etwa ein Mutloser, der die Bemühung aufgegeben hat, aus solchem Mangel befreien? Wenn er sich aber selbstbewusst auf den Weg macht, kann er sogar von großen [Hindernissen] nicht überwältigt werden.
(54) Deshalb werde ich mit festem Geist das besiegen, was mich schwächen will. Wenn ich erst von meinen Schwächen zu Boden geworfen bin, ist der Wille, die Dreiwelt zu beherrschen, lächerlich.
(55) Ich werde alles besiegen. Nichts soll mich besiegen. Als Nachkomme des löwengleichen Siegers muss ich ein solches Selbstbewusstsein tragen.
(56) Doch schwach sind jene Wesen, die der Stolz besiegt hat, und nicht selbstbewusst. Der Selbstbewusste begibt sich nicht unter die Macht des Feindes, jene aber sind beherrscht von ihrem Feind, dem Stolz.
(57) Die vom Stolz aufgeblähten Unglücklichen wirft ihr Stolz in ein leidvolles Dasein. Die Freudenfeste des Menschenlebens macht er zunichte; er macht sie zu Dienern, die das Brot anderer essen müssen. Sie werden dumm, hässlich, schwächlich (58) und von allen erniedrigt. Wenn auch diese Gepeinigten, die vor Stolz starren, zu den starken Selbstbewussten zählen, dann sage, wie die Jammervollen aussehen?
(59) Jene sind wahrhaft stolz, siegreich und tapfer, die das Selbstbewusstsein hochhalten, um über den Feind Stolz zu siegen. Sie, die den Feind Stolz zerschlagen, auch wenn er machtvoll hervorbricht, vollenden in der Welt ganz nach ihrem Wunsch die Frucht ihres Sieges.
(60) Inmitten der Horde von Leidenschaften muss [der Bodhisattva] tausendfach standhafter sein. So unangreifbar von der Schar der Leidenschaften soll er sein wie der Löwe, der durch die Schar der Tiere streift.
(61) Wie ein Mensch auch in einer Notlage sein Auge schützt, so möge er sich, in Bedrängnis geraten, nicht der Gewalt der Leidenschaften ausliefern.
(62) Möge ich ruhig verbrannt oder getötet werden, möge man mir den Kopf abhacken, niemals werde ich mich dem Feind, den Leidenschaften, beugen. So werde ich in allen Situationen nur das Rechte tun.35
(63) Gleich dem Verlangen nach Glück eines Spielgewinns möge sich der [Bodhisattva] ganz seiner jeweiligen Aufgabe hingeben, mit einer unersättlichen Freude an diesem Werk.
(64) Wenn ein Werk auch um des Glückes willen getan wird, ist es nicht sicher, ob es zu Glück führen wird oder nicht. Wenn für ihn aber das Werk selbst das Glück ist, wie kann er dann untätig glücklich sein?
(65) Die Sinnesfreuden gleichen Honig auf der Schneide des Rasiermessers; sie können das Verlangen nie stillen. Wie kann er aber jemals genug haben an den Verdiensten, die die Früchte der Zufriedenheit und des Friedens [des Nirvāṇa] tragen?
(66) Daher begeistere er sich für seine Aufgabe, damit er das Werk vollende, wie der von der Mittagshitze geplagte Elefant sich in den See stürzt, den er gerade erreicht hat.
(67) Schwinden die Kräfte, möge er das Werk zunächst ruhen lassen, um es später wieder aufzunehmen. Auch wenn er ein Werk fertiggestellt hat, soll er es hinter sich lassen, um sich immer weiteren Vorhaben zu widmen.
(68) Wie einer im Duell mit einem kampferprobten Gegner das Schwert führt, so zerschlage er seine Widersacher, die Leidenschaften, und hüte sich vor ihren Waffen.
(69) Wie jener im Kampf das verlorene Schwert aus Furcht rasch wieder ergreift, so soll er das verlorene Schwert der achtsamen Vergegenwärtigung schnell wieder aufnehmen, indem er sich die Schrecken der Höllen vor Augen hält.
(70) Wie sich das Gift im Körper ausbreitet, wenn es in die Blutbahn gelangt, so greift das Übel im Geist um sich, wenn sich ihm eine Gelegenheit bietet.
(71) Der Übende, der die Disziplin [des Bodhisattvas] aufgenommen hat, soll sich seiner Aufgabe mit voller Aufmerksamkeit zuwenden; so wie der Angstvolle, der einen Krug randvoll mit Öl trägt, während jemand neben ihm steht und mit erhobenem Schwert droht, ihn zu töten, falls er es verschüttet.
(72) Stellen sich Schlaf und Trägheit ein, soll er rasch dagegen angehen, wie jemand, der aufspringt, wenn ihm eine Schlange in den Schoß geglitten ist.
(73) Wann immer ein Fehler vorkommt, kritisiere er sich selbst und besinne sich darauf, sich so zu verhalten, dass es ihm nicht wieder geschieht.
(74) „Wie kann ich unter diesen Umständen achtsame Vergegenwärtigung üben?“ Mit dieser Motivation möge er sich der Gemeinschaft [seiner spirituellen Freunde] oder auch den [von ihnen angeratenen] Aufgaben zuwenden.
(75) Um für alle Aufgaben zunächst die innere Stärke zu entwickeln, richte er sich selbst auf und erzeuge Leichtigkeit, indem er sich den Rat zur achtsamen Sorge [um das Streben nach dem Erwachen]25 vergegenwärtigt.
(76) So [leicht] wie die Baumwollflocke dem Kommen und Gehen des Windes gehorcht, so möge er von der Begeisterung für sein Werk beherrscht sein, auf dass es vollendet werde. Anmerkungen zu den Versen
8. Meditative Sammlung
(1) Nachdem [der Bodhisattva] in dieser Weise Tatkraft entwickelt hat, möge er das Denken in der meditativen Konzentration (samādhi) festigen. [Denn] ein Mensch, dessen Geist abgelenkt ist, steckt zwischen den Fangzähnen der Leidenschaften.
(2) Weil Körper und Geist abgeschieden sind, kann Ablenkung nicht aufkommen; deshalb möge er die Welt aufgeben und störende Gedanken gänzlich verbannen.
(3) Aus Begehren und aus dem Verlangen nach Gewinn und anderem löst man sich nicht von der Welt. Daher bedenke der Verständige das Folgende, um [die Welt] aufzugeben:
(4) Man soll zuerst nach geistiger Ruhe streben, nachdem man erkannt hat, dass die Leidenschaften durch die meditative Einsicht (vipaśyanā), die mit der geistigen Ruhe (śamatha) gut verbunden ist,36 vernichtet werden. Die [geistige Ruhe] entsteht aus der Freude des Loslösens von der Welt.37
(5) Welcher Unbeständige könnte an einem anderen Unbeständigen hängen? Denn in tausend Leben wird er den geliebten Menschen nicht wiedersehen.
(6) Wenn man ihn nicht sieht, ist man betrübt, und der Geist erreicht nicht das Gleichgewicht der Meditation. Und selbst wenn man ihn sieht, wird man doch nicht befriedigt, sondern wie zuvor von Verlangen geplagt.
(7) Wenn man an den fühlenden Wesen hängt, wird die Wirklichkeit verschleiert. Das Verlangen macht die Enttäuschung [über den Daseinskreislauf ] zunichte; und am Ende wird man von Kummer geplagt.
(8) Da man nur an ihn denkt, geht dieses Leben sinnlos vorüber. Durch den vergänglichen Freund geht selbst der beständige Dharma verloren.
(9) Wenn man nach der Art der Toren lebt, wird man gewiss in ein schlechtes Dasein geraten. Wenn man von ihnen ins Unheil geführt wird, warum sollte man sich dann mit den Toren zusammentun?
(10) In einem Augenblick schließen sie Freundschaft, in einem Moment werden sie aber auch zu Feinden. Über einen Anlass zur Freude zürnen sie. Die gewöhnlichen Menschen sind wahrlich schwer zufriedenzustellen.
(11) Gibt man ihnen einen guten Rat, werden sie wütend. Mich selbst halten sie von dem ab, was nützlich ist. Wenn man nicht auf sie hört, werden sie zornig und stürzen sich so selbst in ein elendes Dasein.
(12) Gegen den Höheren ist er missgünstig, mit dem Gleichgestellten streitet er, gegen den Niederen ist er überheblich; lobt man ihn, ist er aufgeblasen, sagt man Unangenehmes, wird er zornig: Wann könnte man von dem Toren einen Nutzen haben?
(13) Man lobt sich selbst, schmäht andere, redet über die Freuden der Welt und dergleichen. Irgendetwas Unheilsames ergibt sich ganz sicher für den Toren, der sich zu einem Tor gesellt.
(14) So wird man sich gegenseitig nur zum Verhängnis. Weder nutzt jener einem selbst, noch trägt man selbst etwas zu seinem Wohl bei.
(15) Deshalb muss man vor dem Toren in die Ferne flüchten. Trifft man ihn, nehme man ihn freundlich für sich ein, aber nicht, um sich mit ihm vertraut zu machen, sondern distanziert und souverän.
(16) Wie die Biene den Honig aus der Blüte nimmt, will ich gerade so viel in Besitz nehmen, dass es der Lehre dient, und so mit allen unverwandt leben, wie mit einem, den man zuvor noch nie gesehen hat.
(17) „Ich bin begütert und werde geehrt. Viele Menschen lieben mich.“ Wen eine solche Selbstgefälligkeit erfasst, dem folgt der Schrecken nach dem Tod.
(18) All die vielfältigen Dinge, die der verblendete Geist jetzt begehrt, werden ihm später tausendfach verstärkt als Leiden vorgehalten werden.
(19) Deshalb begehrt der Weise nicht; aus Begehren entsteht Furcht. Weil diese [Dinge] sich von selbst auflösen, bleibe man gelassen und betrachte [die Vergänglichkeit der Welt].
(20) Es gab schon viele Reiche, Berühmte und Geehrte, doch weiß man nicht, wohin sie mit ihrem Reichtum und Ruhm gegangen sind.
(21) Wozu das Vergnügen aufgrund eines Lobes, wenn es andere gibt, die mich tadeln? Wozu das Missvergnügen aufgrund eines Tadels, wenn es andere gibt, die mich loben?
(22) Wenn selbst der Buddha die vielfältigen Wünsche der Wesen nicht erfüllen konnte, wie sollte mir Unfähigem das gelingen? Deshalb will ich die weltlichen Sorgen aufgeben.
(23) Die Wesen verachten den Besitzlosen und über den Reichen reden sie schlecht. Wie sollte durch jene, mit denen von Natur her schwer zusammenzuleben ist, Freude aufkommen?
(24) Da bei dem Toren Zuneigung nie ohne Eigennutz entsteht, haben die Vollendeten gelehrt, dass der Tor niemandem ein Freund ist.
(25) Die Tiere in der Wildnis, die Vögel und die Bäume reden nichts Schlechtes. Wann werde ich endlich mit ihnen zusammenleben, die so angenehm im Umgang sind?
(26) Wann nur werde ich, frei von Verlangen und ohne zurückzublicken, in Höhlen, leeren Tempeln oder am Fuße eines Baumes verweilen?
(27) Wann nur werde ich unabhängig und frei von Begehren leben, in weiten Gegenden der Natur, die niemandem gehören?
(28) Wann nur werde ich furchtlos wandeln, ohne auf den Körper zu achten, nur eine Bettelschale und andere wenige Habseligkeiten besitzend und mit Kleidung, die niemand mehr braucht?
(29) Wann nur werde ich mich zur Leichenstätte begeben, um diesen vergänglichen Körper mit den Skeletten der anderen zu vergleichen?
(30) Denn dieser Körper wird ebenso werden wie diese [Leichen] und wegen seines Gestanks werden sich selbst die Schakale nicht in seine Nähe wagen.
(31) Obwohl er als ein Organismus erscheint, werden das Fleisch und die Knochen, die zu ihm gehören, auseinanderfallen. Um wie viel mehr gilt dies für meine Verbindung zu den von mir geliebten Menschen?
(32) Allein wird [der Mensch] geboren und allein stirbt er. Kein anderer übernimmt einen Teil seines Leidens. Was habe ich von den Lieben, die [meinen Heilsweg] behindern?
(33) Wie Reisende auf ihren Wegen sich eine Unterkunft nehmen, so nehmen sich jene, die auf der Straße der Existenzen reisen, die Unterkunft einer Geburt.
(34) Solange man noch nicht von vier Männern fortgetragen wird, beweint von der Welt, möge man sich in die Waldeinsamkeit begeben.
(35) Befreit von Vertrautheit und Zorn, verweilt der Körper allein in Abgeschiedenheit. Schon vorher wie tot betrachtet, gibt es niemanden, der ihn betrauert, wenn man wirklich stirbt.
(36) Niemand steht daneben und belästigt ihn mit seinem Klagen; niemand lenkt ihn von der Vergegenwärtigung des Buddhas ab.
(37) Deshalb will ich allein in der lieblichen Waldeinsamkeit leben, ohne Mühen, glücklich, frei von allen Ablenkungen.
(38) Frei von allen anderen Gedanken und die Aufmerksamkeit allein auf den eigenen [Geist] gerichtet, will ich danach trachten, den Geist in der Ruhe der Meditation zu vertiefen und ihn zu zähmen.
(39) Die Sinnesfreuden schaffen Unheil in dieser und auch in zukünftigen Welten. Hier bewirken sie Tod, Gefangenschaft und Verstümmelung, dort die Höllen und andere [Leiden].
(40) [Der Körper der Geliebten,] für den du zuvor viele Male Kuppler und Kupplerinnen [um Hilfe] gebeten hast, für den du weder Übeltaten noch schlechten Ruf gescheut hast, (41) für den du dich sogar in Gefahr begeben und deine Güter verbraucht hast, den zu umarmen dir die höchste Seligkeit gewesen ist ‒ eben dieser [Körper] (42) ist nur ein Skelett, nichts anderes, unabhängig und ohne Besitzer. Warum erfährst du nicht Glückseligkeit, indem du es ebenso leidenschaftlich liebst?
(43) Mühevoll hast du zuvor versucht, dieses Gesicht dazu zu bewegen, zu dir aufzublicken und dich anzuschauen, doch aus Scham blickte es zu Boden. Ob du den Blick erhaschen konntest oder nicht, war es doch vom Schleier bedeckt.
(44) Dieses leidenschaftlich begehrte Gesicht ist nun von den Geiern entblößt, und du kannst es unverhüllt betrachten. Warum fliehst du jetzt?
(45) Das, was du sogar vor den Blicken anderer wohl behütet hast, wird nun von den [Geiern] verschlungen. Warum, Eifersüchtiger, schützt du es jetzt nicht?
(46) Nachdem du [nun] gesehen hast, wie die Geier und andere sich diesen Haufen von Fleisch zur Beute machen, warum ehrst du [weiter] die Nahrung anderer mit Blumengirlanden, Sandelholzduft und Schmuck?
(47) Wenn du ihn als Skelett siehst, bereitet dir der Anblick [jenes Körpers] Entsetzen, obwohl er sich nicht rührt. Warum fürchtest du dich vor ihm nicht, wenn er wie durch einen Dämon bewegt wird?
(48) Warum begehrst du das [Skelett], das du verlangtest, obwohl es bedeckt war, nicht auch [jetzt], da es unbedeckt ist? Wenn du denkst, es sei sinnlos [ein Skelett zu umarmen], warum umarmst du es dann, wenn es bedeckt ist?
(49) Kot und Speichel sind aus derselben Nahrung entstanden. Warum verabscheust du den Kot und liebst den Speichel?
(50) Mit Baumwolle gefüllte, flauschige Kissen mögen sie nicht, weil sie keinen üblen Geruch verströmen. Wie verblendet sind die Begehrenden über das Unreine!
(51) Verblendet und übel sind die Lustvollen: Sogar auf die weiche Baumwolle werden sie wütend, weil sie nicht mit ihr schlafen können.38
(52) Das Unreine begehrst du nicht, aber warum umarmst du dann das andere Knochengerüst, das von Sehnen zusammengehalten und mit Schlamm aus Fleisch zugekleistert ist?
(53) Du selbst hast genügend Unrat, woran du dich dauernd erfreuen kannst. Aber aus Verlangen nach dem Unreinen begehrst du auch noch die anderen Kotsäcke.
(54) „Ich liebe dieses Fleisch“, sagst du und bist begierig, es zu sehen und zu berühren. Aber wie kannst du nach Fleisch verlangen, das doch in seinem Wesen ohne Bewusstsein ist?
(55) Jenen Geist aber, den du [eigentlich] begehrst, kannst du weder anschauen noch berühren. Und was du sehen und berühren kannst, ist ohne Bewusstsein. Wozu diese sinnlose Umarmung?
(56) Dass du die unreine Natur des Körpers anderer nicht erkennst, erstaunt nicht besonders. Sehr verwunderlich ist aber, dass du die Unreinheit deines eigenen nicht begreifst!
(57) Warum verschmähst du, aus der Sucht nach Unreinem, eine junge Lotosblume, welche von den Strahlen der Sonne aus wolkenlosem Himmel geöffnet wurde, und findest stattdessen Gefallen an einem Haufen Unrat?
(58) Wenn du den Erdboden, der von Exkrementen bedeckt ist, nicht berühren möchtest, warum willst du dann den Körper berühren, von dem diese [Exkremente] gekommen sind?
(59) Wenn du das Unreine nicht begehrst, warum suchst du dann die Vereinigung mit dem anderen [Körper]? Dieser ist ja das Produkt eines Samens, der aus jenem Nährboden von Unreinheiten hervorgegangen ist.
(60) Selbst den aus Exkrementen entstandenen Wurm magst du nicht; doch den aus vielen Unreinheiten bestehenden Körper begehrst du, obwohl er ebenso aus unreinen Substanzen entstanden ist.
(61) Nicht genug damit, dass du deine eigenen Unreinheiten nicht verschmähst; aus deinem Verlangen nach Unrat begehrst du auch noch den anderen Kotsack.
(62) Selbst schmackhafter Kampfer und andere [Gewürze], gekochter Reis oder Gemüse verschmutzen die Erde erst dann mit ihrer Unreinheit, wenn man sie in den Mund gesteckt und wieder ausgespuckt hat.
(63) Wenn du an dieser offenkundigen Unreinheit zweifelst, betrachte doch auch die anderen unreinen Körper, die auf den Leichenstätten hinterlassen wurden.
(64) Warum erfreust du dich immer wieder gerade an dem, von dem du weißt, dass es dich ungeheuer entsetzt, wenn seine Haut entfernt wird?
(65) Der Duft, mit dem man den Körper einreibt, ist allein der des Sandelholzes oder anderer Substanzen, nichts anderes. Warum begehrst du das eine aufgrund des Dufts, der von einem anderen kommt?
(66) Ist es nicht von Vorteil, wenn aufgrund seines natürlichen üblen Geruchs keine Begierde zum [Körper] entsteht? Warum bedecken ihn die Weltlichen, die sich am Sinnlosen erfreuen, mit Wohlgerüchen?
(67) Wenn doch der Wohlgeruch der des Sandelholzes ist, wie könnte er vom Körper stammen? Warum begehrst du etwas aufgrund eines fremden Geruchs?
(68) Wenn der nackte Körper, mit langen Haaren und Nägeln, gelben Zähnen, in einer übelriechenden Schmutzhülle, von Natur erschreckend ist, (69) warum wird er dann so mühsam poliert wie ein Schwert, um sich selbst damit zu verletzen? Die ganze Erde ist in Aufregung durch die Anstrengungen der Wahnsinnigen, die über sich selbst verblendet sind.
(70) Wenn du vom Anblick einiger Skelette auf dem Leichenacker angeekelt bist, wie kannst du dich dann in der Stadt vergnügen, jenem Leichenacker, auf dem es von laufenden Skeletten wimmelt?
(71) Und selbst diesen unreinen [Körper der Geliebten] bekommt man nicht ohne Preis. Um ihn in Besitz zu nehmen, muss man mit harter Arbeit und den Verletzungen in den Höllen und anderen [leidvollen Lebensformen] zahlen.
(72) Das Kind ist nicht in der Lage, Reichtum zu erwerben; wie könnte es also dadurch in der Jugend glücklich sein? Wenn das Leben mit dem Anhäufen von Reichtum vorübergegangen ist, was soll man, erst einmal gealtert, dann mit den Freuden der Sinne?
(73) Einige, die schlimmer Begierde verfallen sind, erschöpfen sich tagsüber vollständig durch Arbeit; wenn sie am Abend nach Hause gekommen sind, legen sie ihren ermatteten Körper zu Bett wie einen Leichnam.
(74) Einige leiden an der Mühsal langer Feldzüge und der Fremde. Obwohl sie sich nach ihrer Familie sehnen, sehen sie Frau und Kinder jahrelang nicht.
(75) Aus Verblendung lassen sie, die ihren eigenen Nutzen suchen, sich von anderen zur Arbeit antreiben, ohne aber das zu erreichen, wofür sie sich sogar verkaufen.
(76) Einige verkaufen ihren Körper und lassen sich willenlos von anderen befehlen. Und wenn die Frau das Kind zur Welt bringt, muss sie es einsam unter einem Baum gebären.
(77) Die Toren, die von ihrer Begierde getäuscht sind, ziehen in Schlachten. Sie gefährden Leib und Leben in der Erwartung, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und später das Verdiente genießen zu können. Um des Profits willen machen sie sich zu Sklaven.
(78) Man kann sehen, dass einige Habgierige verstümmelt werden, andere gepfählt, wieder andere mit Lanzen erstochen, und einige werden verbrannt.
(79) Erkenne, dass Reichtum ein nicht endendes Unglück ist ‒ wegen der Qualen des Erwerbs, des Bewahrens und des Verlustes. Jene, die von ihrer Begierde nach Besitz abgelenkt sind, haben keine Chance, sich aus dem Leiden des Daseins zu befreien.
(80) So erleben die Lustvollen viele Nachteile wie die zuvor genannten. Der Gewinn fällt klein aus, wie beim Vieh, das den Karren zieht und dafür nur wenige Happen Heu als Futter bekommt.
(81) Für einen nur geringen Genuss, wie er selbst vom Vieh nicht schwer zu erlangen ist, vernichten die Menschen, die von ihrem selbstgeschaffenen Schicksal überwältigt sind, dieses schwer zu erlangende Glück der Freiheiten und günstigen Umstände.
(82) Wenn man die andauernden Mühen bedenkt, die man auf sich nimmt, um die geringen, vergänglichen Sinnesfreuden zu erreichen, obgleich man durch sie in die Höllen und andere leidvolle Daseinsbereiche gestürzt wird, (83) so würde man mit einem Bruchteil dieser Anstrengungen die Buddhaschaft verwirklichen können. Das Leiden, das durch das Begehren entsteht, ist groß, verglichen mit dem Leiden auf dem Lebensweg zum Erwachen, und doch erreichen sie das Erwachen nicht.
(84) Angesichts der Leiden der Höllen und dergleichen sind weder Schwert noch Gift, weder Feuer noch Abgrund noch Feind mit den [Nachteilen der] Sinnesfreuden vergleichbar.
(85) In dieser Weise von den Sinnesfreuden ernüchtert, möge man sich an der Abgeschiedenheit erfreuen in Wäldern, die frei von Streit und Anstrengung und friedlich sind.
(86) Die Glücklichen wandeln in ihrem lieblichen Palast auf weiten Felsflächen, gekühlt von Sandelholzduft und Mondlicht, wo ein lautloser, friedvoller Wind des Waldes weht, und kontemplieren, was dem Wohle der anderen dient.
(87) In einer leeren Behausung, unter einem Baum oder in Höhlen wohnt er, solange er möchte. Die Mühsal, den Besitz zu hüten, hat er aufgegeben; ohne Verpflichtungen führt er ein freies und sorgloses Leben.
(88) Das Glück der Zufriedenheit, das der genießt, der nach eigenem Willen lebt, nichts begehrt und an niemanden gebunden ist, ist selbst für Indra schwer zu erlangen.
(89) Nachdem man mit diesen und anderen Überlegungen die Vorzüge der Abgeschiedenheit bedacht hat, möge man die störenden Gedanken ganz zur Ruhe bringen und sich der Meditation des Strebens nach dem Erwachen widmen.
(90) Zuerst bemühe man sich, die Gleichheit des Selbst und des anderen zu meditieren: Weil wir gleich sind in Bezug auf Glück und Leiden, muss ich alle beschützen wie mich selbst.
(91) Obwohl die Körperteile wie die Hand usw. unterschiedlich sind, gleichen sich alle darin, dass sie als Körper geschützt werden müssen. Genauso sind die vielfältigen Lebewesen mit ihren eigenen Freuden und Schmerzen alle gleich darin, dass sie nach Glück verlangen wie ich.
(92) Obwohl mein Schmerz nicht die Körper der anderen plagt, empfinde ich es doch als mein eigenes Leiden, das aufgrund meiner Auffassung vom Selbst für mich unerträglich ist.
(93) Und auch wenn mich die Leiden der anderen nicht erfassen, so werden sie doch von ihnen ebenso als ihre eigenen Leiden erlebt, die aufgrund ihrer Auffassung vom Selbst für sie schwer zu ertragen sind.
(94) Das Leiden der anderen muss ich beseitigen, weil es Leiden ist wie mein eigenes. Und ich muss den anderen helfen, weil sie fühlende Wesen sind wie ich selbst.
(95) Wenn beide, ich und die anderen, gleich darin sind, dass wir Glück wünschen, was zeichnet mich selbst dann vor den anderen aus, dass ich mich nur um mein eigenes Glück bemühe?
(96) Wenn beide, ich und die anderen, gleich darin sind, dass wir kein Leiden wünschen, was zeichnet mich selbst dann vor den anderen aus, dass ich mich nur selbst beschütze und nicht auch die anderen?
(97) Wenn ich jene nicht schützen muss, weil ihr Leiden mir keinen Schaden zufügt, warum schütze ich mich dann vor den Leiden der Zukunft, die mir [jetzt] auch keinen Schmerz verursachen?
(98) Der Gedanke, dass ich es sei, der jenes [zukünftige Leiden] erleben wird, ist falsch; denn der hier stirbt, ist ein anderer [als jener, der dort geboren wird], und der [dort] geboren wird, ist ein anderer [als dieser, der hier gelebt hat].
(99) Wenn gelten sollte, dass nur derjenige, der das Leiden erlebt, sich selbst behüten muss, warum soll dann die Hand den Fuß schützen, wird doch der Schmerz des Fußes nicht von der Hand erlebt?
(100) Wenn du sagst, diese [Einstellung, dich nur persönlich schützen zu müssen,] sei zwar nicht gerechtfertigt, aber sie wirke [naturgemäß] aufgrund der Wahrnehmung eines Selbst, so [bedenke], dass das, was falsch ist, sei es bei einem selbst oder anderen, in jedem Fall nach Kräften aufgegeben werden muss.
(101) Was als „Kontinuum“ oder „Organismus“ bezeichnet wird ist ebenso irreal, wie eine Kette oder ein Heer. Jene, zu denen das Leiden gehört, gibt es nicht; wem sollte es also zu eigen sein?
(102) Dass es keinen Besitzer des Leidens gibt, gilt für alle ohne Unterschied. Leiden sind zu beseitigen, weil sie Leiden sind. Welchen Sinn hat da eine Begrenzung [auf das eigene Leiden]?
(103) „Warum sollte jede Form von Leiden beseitigt werden, [wenn es doch keinen Besitzer des Leidens gibt]?“ ‒ Weil darüber keine Meinungsverschiedenheit besteht. Wenn es aber beseitigt werden muss, dann bei allen; wenn nicht, dann auch nicht bei mir, genauso wenig wie im Fall der anderen.
(104) „Wenn durch das Mitleid das Leiden vermehrt wird, warum sollte ich es dann mit Kraft entfalten?“ ‒ Aber wie kann angesichts des Leidens in der Welt das Leiden des Mitleids groß genannt werden?
(105) Wenn durch das Leiden eines einzigen das Leiden vieler beendet wird, so hat ein mitfühlender Mensch die Pflicht, dieses Leiden anzunehmen, um sich und anderen Heil zu bringen.
(106) Deshalb ist der [Bodhisattva] Supuṣpacandra dem eigenen Leiden nicht ausgewichen, um das Leiden vieler zu beenden, obwohl er wusste, dass ihm vom König Schaden drohte.
(107) Jene, die in dieser Weise ihren Geistesstrom geübt haben, stürzen sich aus der Freude, das Leiden der anderen zu lindern, selbst in die schlimmste Hölle wie Gänse in einen Lotosteich.
(108) Ist nicht jener Ozean der Freude, wenn die fühlenden Wesen erlöst werden, das erhabenste [Glück]? Was will man dann noch mit dem Glück der [eigenen] Befreiung?
(109) Wenn [der Bodhisattva] auch das Wohl der anderen bewirkt hat, ist er weder überheblich noch von sich eingenommen. Weil er einzig Freude an dem Wohl der anderen empfindet, hat er keine Erwartung, durch die reifende Frucht [belohnt zu werden].
(110) So wie ich mich schon vor geringfügigen Unannehmlichkeiten, etwa vor einer Verleumdung, selbst schütze, will ich daher gegenüber den anderen eine schützende und mitfühlende Geisteshaltung praktizieren.
(111) Aus Gewohnheit nehme ich die Vereinigung der Samen- und Blutstropfen, die von anderen stammen, mit dem Bewusstsein wahr, „das bin ich“, obwohl sie das von sich her gar nicht sind.
(112) Warum sollte man nicht ebenso die Körper anderer mit dem gleichen Gedanken „ich“ erfassen können? Dass der eigene Körper einer von anderen ist, steht ja bereits fest. Somit ist diese [vertauschte] Position [von Selbst und anderen] leicht einzunehmen.
(113) Indem ich nun das Selbst als fehlerhaft und die anderen als Ozeane von Vorzügen betrachte, werde ich meditieren, die Perspektive des Selbst aufzugeben und die [Position der] anderen einzunehmen.
(114) Die Hände und die übrigen [Glieder] sieht man [gleichermaßen] als Teile des Körpers an; warum betrachtet man nicht genauso all die Wesen als Teile der lebendigen Welt?
(115) Durch Gewohnheit bezieht man das Bewusstsein des Selbst auf diesen Körper, obwohl er von sich her gar kein Selbst ist. Warum sollte also nicht auch mit Bezug auf die anderen Wesen die Wahrnehmung des Selbst durch Gewöhnung entstehen?
(116) Wenn man mit dieser Einstellung etwas für andere getan hat, wird man weder überheblich, noch gibt man damit an. Und man erwartet auch keine Belohnung, denn es ist ja, als wenn man sich selbst zu essen gegeben hätte.
(117) So wie man sich schon vor geringfügigen Unannehmlichkeiten, etwa vor einer Verleumdung, selbst schützt, möge man daher gegenüber den anderen die Geisteshaltungen des Schützens und des Mitfühlens kultivieren.
(118) Aus diesem Grund hat der Beschützer Avalokiteśvara aus großem Mitgefühl sogar seinen Namen gesegnet, um einem Menschen, der in einer Versammlung [an ihn denkt], die Angst der Unsicherheit zu nehmen.
(119) Vor einer schwierige Aufgabe soll man nicht zurückweichen. Denn durch die Kraft der Gewöhnung wird man bald nicht mehr ohne diese Sache sein wollen, vor der man sich zuvor fürchtete, wenn man nur davon hörte.
(120) Wer sich selbst und die anderen schnell retten möchte, möge dieses heilige Geheimnis üben, sich selbst gegen die anderen auszutauschen.
(121) Wegen des Hängens am Selbst39 entsteht Furcht schon bei geringer Gefahr. Wer sollte das mit Angst besetzte Selbst nicht verabscheuen wie einen Feind?
(122) Wenn dieses Selbst mit dem Ziel, Krankheit, Hunger und Durst und dergleichen abzuwehren, Vögel, Fische und Wildtiere tötet und [anderen] am Wege auflauert, (123) wenn es um des Profits oder der Ehre willen selbst Vater und Mutter ermordet oder den Besitz der Drei Juwelen raubt, so dass es in den schlimmsten Höllen verbrannt wird, (124) welcher Weise würde dieses Selbst dann begehren, es schützen und verehren? Wer würde es nicht wie einen Feind ansehen und es nicht verachten?
(125) „Was bleibt für mich, wenn ich es weggebe?“ ‒ das ist der Egoismus von der Art der Dämonen. „Was kann ich weggeben, wenn ich es für mich behalte?“ ‒ das ist der Altruismus nach dem Dharma der Götter.
(126) Hat man für seine eigenen Interessen andere gequält, wird man in den Höllen gepeinigt werden. Hat man aber für andere sich selbst gequält, wird man alles Vortreffliche erlangen.
(127) Das Verlangen, sich selbst zu erhöhen, führt zu schlechtem Dasein, niedriger Stellung und Dummheit; überträgt man diese Haltung auf die anderen, erlangt man ein glückliches Dasein und Ehre.
(128) Hat man zum eigenen Nutzen über die anderen verfügt, wird man Sklaverei und dergleichen erleben. Hat man sich selbst zum Wohl der anderen hingegeben, wird man Führerschaft und ähnliches erleben.
(129) Was immer es an Glück gibt in der Welt, all das ist aus dem Wunsch nach dem Glück der anderen entstanden. Was immer es an Leiden gibt in der Welt, das alles ist aus dem Verlangen nach dem eigenen Glück entstanden.
(130) Wozu viele Erklärungen? Betrachte doch den Unterschied zwischen den Toren, die den eigenen Nutzen verfolgen, und den Buddhas, die zum Wohl der anderen wirken.
(131) Wenn man das eigene Glück nicht gegen das Leiden der anderen tauscht, ist die Buddhaschaft gewiss nicht zu verwirklichen, und selbst im Kreislauf der Existenzen gibt es kein Glück.
(132) Lassen wir einmal die jenseitige Welt. Schon die Ziele dieses Lebens werden nicht erreicht, wenn der Diener nicht sein Werk tut und der Herr nicht den Lohn gibt.
(133) Die Verblendeten verwerfen die vortreffliche Freude, die in der sichtbaren und in der unsichtbaren [Welt] Glück bringt. Stattdessen wählen sie schreckliche Qual, indem sie anderen Leiden bereiten.
(134) Was immer es in den Welten an Verletzungen gibt, an Gefahren und Leiden, das alles ist aus der Vorstellung des eigenen Selbst entstanden. Was also soll mir dieser schreckliche Dämon nutzen?
(135) Ohne das Selbst aufzugeben, kann man dem Leiden nicht entgehen, so wie man dem Brennen nicht entgehen kann, ohne das Feuer zu meiden.
(136) Deshalb will ich, um den eigenen Schaden und das Leiden der anderen zu beenden, mich selbst den anderen schenken und die anderen wie mich selbst annehmen.
(137) „Ich gehöre den anderen.“ - Sei dir dessen gewiss, mein Geist! Von nun an wirst du an nichts anderes mehr denken als an das Wohl aller Wesen.
(138) Es ist nicht recht, dass die Augen und die übrigen [Sinnesorgane], die nun den anderen gehören, zum eigenen Nutzen handeln; es ist nicht recht, dass die Augen und so fort, die ihrem Wohl [gewidmet sind], sich im Gegensatz dazu verhalten.
(139) Daher seien dir die Wesen das Kostbarste, und was immer du an deinem Körper siehst, all das entziehe ihm und nutze es zum Wohl der anderen.
(140) Indem man nun als Selbst die Position eines Niedrigeren, [eines Gleichen und eines Höheren] einnimmt und das [herkömmliche] Selbst als den anderen betrachtet, kultiviere man mit sorglosem Geist Neid, Rivalität und Stolz:
(141) Jener wird geehrt, ich nicht; ich bin nicht reich wie er; jener wird gelobt, ich werde getadelt; jener ist glücklich, ich leide.
(142) Ich erledige die Arbeit, er lässt es sich gutgehen; er ist als ein großer Mensch in der Welt bekannt, ich gelte als gering und wertlos.
(143) Warum werden wir kritisiert dafür, dass wir ohne Vorzüge sind? Jedes Selbst hat gewiss Vorzüge [die es entwickeln kann]. Und es gibt genügend Leute, im Vergleich zu denen er niedrig ist, wie es auch solche gibt, im Vergleich zu denen ich besser bin.
(144) Der Verfall meiner ethischen Disziplin, meiner Ansichten usw. kommt von der Kraft der Leidenschaften, nicht von mir selbst. Mit aller Kraft soll er uns heilen; die Mühsal dabei würde ich sogar auf mich nehmen.
(145) Wenn er mich aber schon nicht heilen will, warum verachtet er mich? Was nützen mir seine Vorzüge? Er selbst aber behält seine Vorzüge für sich.
(146) Er hat kein Mitleid mit den Wesen, die im Rachen der niedrigen Daseinsbereiche stecken, und doch maßt er sich aus Selbstüberschätzung sogar an, mit seinen Vorzügen die Weisen zu übertreffen.
(147) Im Wettstreit mit ihm, der mir gleich ist, werde ich entschlossen alles tun, um ihn an Reichtum und Ansehen zu übertreffen, und sei es mit den Mitteln des Kampfes.
(148) Mit allen Mitteln werde ich meine eigenen Vorzüge der ganzen Welt zeigen; niemanden werde ich von seinen Vorzügen hören lassen.
(149) Meine eigenen Fehler werde ich verbergen, und so werde ich es sein, der geehrt wird, nicht er. Ich werde von nun an Reichtümer erlangen, und so werde ich es sein, der geachtet wird, nicht er.
(150) Schließlich ergötze ich mich daran, dass er schlechtgemacht wird. Zum Gespött aller Leute soll er werden, von diesen und jenen verschmäht.
(151) Dieser Elende will sich tatsächlich mit mir messen! Glaubt er denn wirklich, er könne mir an Gelehrtheit, Intelligenz, Schönheit, Familie oder Reichtum gleichkommen?
(152) Wenn ich höre, dass sich die Kunde meiner Vorzüge überall verbreitet, genieße ich das Glücksgefühl ausgiebig, bis ich vor Freude eine Gänsehaut bekomme.
(153) Wenn er auch Güter besäße, so müsste ich sie ihm mit Gewalt entreißen und ihm davon nur das Lebensnotwendige lassen, falls er meine Arbeit tut.
(154) Sein Glück werde ich ihm nehmen und ihm stets meine Leiden aufladen. Hundertfach hat er mir in all den [Existenzen] im Daseinskreislauf Schaden bereitet.
(155) Du, mein Geist! In dem Begehren, deine eigenen Ziele zu erreichen, sind zwar unzählige Zeitalter verstrichen, doch hast du mit dieser großen Anstrengung nichts gewonnen als Leiden.
(156) Deshalb widme dich entschlossen ganz dem Wohl der anderen! Die Vorteile davon wirst du später sehen, denn die Worte des Buddhas täuschen nicht.
(157) Wenn du dieses Werk schon früher getan hättest, könntest du unmöglich noch in dieser Lage sein, in der du die vollkommene Glückseligkeit eines Buddhas nicht erreicht hast.
(158) Wie du das Bewusstsein des Ich auf die fremden Tropfen von Samen und Blut bezogen hast, so gewöhne dich nun daran, es auch mit den anderen [Wesen] zu verbinden.
(159) Indem du dich zum Spion der anderen machst, nimm diesem Körper alles, was du an ihm findest, und nütze es dann zum Wohl der anderen.
(160) Dieses Selbst ist glücklich, dem anderen geht es schlecht; dieses Selbst steht über allen, das andere ist niedrig; dieses Selbst tut Nützliches, das andere nicht: Wie kann man auf das Selbst nicht eifersüchtig sein?
(161) Nimm dem Selbst das Glück, übertrage ihm das Leiden der anderen. Achte wachsam auf die Fehler des Selbst: „Wann tut es was?“
(162) Auch wenn es einen Fehler nicht selbst beging, stelle ihn als den seinen dar. Doch wenn es selbst auch nur geringe Schuld trifft, lege sie vor vielen Menschen offen!
(163) Indem du den Ruhm der anderen verbreitest, lasse seinen eigenen Ruhm verblassen. So wie dem niedrigsten aller Diener, trage ihm alle Aufgaben [der Lebewesen] an.
(164) Dieses [Selbst] ist in seinem Wesen mit Fehlern behaftet, also lobe es nicht wegen zufälliger Tugenden. Lass niemanden von seinen Vorzügen erfahren.
(165) Kurz, was immer du aus Eigennutz anderen an Schaden zugefügt hast, lasse diesen Schaden nun zum Nutzen der Wesen auf eben dieses Selbst zurückfallen.
(166) Lasse nicht zu, dass sich dieses [Selbst] rau und vor Stärke anmaßend gebärdet; schamhaft, furchtsam und gezügelt soll es sein, wie eine frisch vermählte Braut.
(167) „Tue dieses, verhalte dich so, unterlasse jenes!“ ‒ so muss man dieses [Selbst] beherrschen. Übertritt es diese Regeln, muss es bestraft werden.
(168) Wenn du dich aber, mein Geist, trotz solcher Anweisungen anders verhältst, werde ich dich ohne Zaudern bestrafen, denn alles Übel geht von dir aus.
(169) Die Zeiten, als ich von dir ins Verderben gestürzt wurde, haben sich geändert. Ich sehe dich. Wohin willst du jetzt noch gehen? All deine Überheblichkeit werde ich vernichten.
(170) Von nun an gib alle Hoffnung auf, es gäbe noch deine eigennützigen Interessen. An die anderen habe ich dich verkauft; nun sei nicht bedrückt, sondern schenke [ihnen] deine Fähigkeiten!
(171) Wenn [ich] dich aus Achtlosigkeit nicht den Lebewesen hingebe, wirst du mich zweifellos an die Höllenwächter ausliefern.
(172) So hast du mich schon [oft] den Höllenwächtern übergeben und mich über lange Zeit gequält! Von nun an aber werde ich deine feindseligen Angriffe nicht vergessen und all deine eigensüchtigen Gedanken vernichten.
(173) Wenn du dich selbst liebst, darfst du dich nicht selbst lieben. Wenn du dich selbst zu schützen wünschst, musst du stets die anderen schützen.
(174) Je mehr du diesen Körper behütest, je mehr sinkt er hinab und wird ein Weichling.
(175) Doch selbst, wenn er auf diese Weise gefallen ist, reicht die ganze Erde nicht, um seine Erwartungen zu erfüllen. Wer sollte dann sein Verlangen stillen können?
(176) Wer nach Unmöglichem verlangt, wird frustriert und verliert seine Hoffnung. Wer aber keine Erwartungen hat, dessen Reichtum ist unerschöpflich.
(177) Deshalb darf man dem Körper keine Gelegenheit geben, seine Wünsche anwachsen zu lassen. Denn das Reizvolle nicht zu ergreifen – darin liegt der kostbare Besitz.
(178) Warum hältst du dieses erschreckende, unreine Gebilde für ein Selbst, wenn es doch schließlich zu Staub werden wird, und wenn es, selbst reglos, nur von anderem bewegt wird?
(179) Was habe ich von diesem Apparat, mag er tot oder lebendig sein? Was ist es, das ihn von einem Klumpen Lehm unterscheidet? Ach, mein Stolz hört einfach nicht auf!
(180) Indem ich dem Körper diente, habe ich viele sinnlose Leiden angehäuft. Und was nützen ihm, der wie Holz ist, das Begehren und der Zorn?
(181) Ob ich ihn derart behüte oder ob ihn die Geier fressen, er zeigt weder Zuneigung noch Hass. Warum also hänge ich an ihm?
(182) Wenn er gar nicht erkennt, dass durch seine Erniedrigung Zorn und durch sein Lob Freude entstehen, für wen verausgabe ich mich?
(183) „Jene, die diesen Körper lieben, sind meine Freunde“, so sagt man. Doch alle lieben ihren eigenen Körper; warum schätze ich sie dann nicht [als Freunde]?
(184) Deshalb will ich an dem Körper nicht haften, sondern ihn hingeben, um durch ihn den Lebewesen zu nützen. Und aus diesem Grund muss ich ihn trotz seiner vielen Fehler behüten, während er seine Aufgabe verrichtet.
(185) Genug also von dem Lebenswandel eines Toren! Den Weisen will ich folgen und im Gedanken an die Lehren zur Achtsamkeit Schlaf und Dumpfheit überwinden.
(186) So wie die Nachkommen der Buddhas mit ihrem großen Mitgefühl will ich meinen Geist fest im Guten verankern; denn wie sollte mein Leiden zu Ende gehen, wenn ich mich nicht Tag und Nacht fortwährend bemühe?
(187) Um die Hindernisse zu beseitigen, werde ich daher den Geist von falschen Wegen abwenden und ihn in der Ruhe der Versenkung beständig auf sein fehlerfreies Meditationsobjekt richten.
9. Weisheit
(1) Alle diese Zweige hat der Weise zum Zwecke der Weisheit (prajñā) gelehrt. Daher möge [der Bodhisattva] mit dem Wunsch, das Leiden zu beenden, die Weisheit entwickeln.
(2) Die Wahrheit wird als zweifach beschrieben, als vordergründige [konventionelle] und als endgültige. Das Endgültige ist nicht die Domäne des Intellekts. Der Intellekt wird als Konvention bezeichnet.
(3) Im Hinblick auf diese [zweifache Wahrheit] sind zwei Arten von Menschen zu unterscheiden: die Yogis und die gewöhnlichen Menschen. Dabei werden die gewöhnlichen Menschen von jenen [mit der Sicht eines] Yogis widerlegt.
(4) Und auch bei den Yogis entkräften die weiter fortgeschrittenen die weniger entwickelten durch den Unterschied im Grad ihrer Erkenntnis, und zwar mit Vergleichen [für etwas Unwirkliches], die beide akzeptieren. [Doch] zum Zwecke des Resultats hinterfragen sie die [vordergründigen Konventionen] nicht.40
(5) Von den gewöhnlichexn Menschen werden die Dinge gesehen und genauso als wirklich aufgefasst und nicht einer Illusion gleich. Deshalb sind sich in diesem Punkt die Yogis und die Weltlichen uneinig.
(6) Selbst das unmittelbar Wahrgenommene wie das Körperliche usw. besteht nur als Konvention und nicht aufgrund gültiger Erkenntnis. Die Konventionen aber sind falsch [und nicht im endgültigen Sinne wahr], vergleichbar mit jener konventionellen Meinung, nach der das Unreine als rein gilt.
(7) Der Beschützer hat die [Vergänglichkeit der] Dinge gelehrt, um die weltlichen Menschen [an die Erkenntnis der Wirklichkeit] heranzuführen. Doch als Wirklichkeit gibt es keine augenblicklichen Dinge. [Einwand: Diese Sicht lässt die Dinge ja nicht einmal als konventionelle Wirklichkeit gelten] und steht sogar im Widerspruch zu der Konvention.
(8) [Mādhyamika:] Nein, dieser Fehler besteht nicht. Denn der Yogi [kennt] die Konventionen. Im Vergleich zur Welt jedoch sieht er die Realität; andernfalls würde [die Sicht des Yogi, der beispielsweise den Körper] einer Frau als unrein auffasst, von der weltlichen Sicht widerlegt werden.
(9) Das Verdienst aus [der Verehrung] der illusionsgleichen Buddhas [entsteht] genauso wie das Verdienst bei jenen, die an die [wahre] Wirklichkeit [des Buddhas glauben]. [Einwand:] Aber wie soll ein Lebewesen nach dem Tod wiedergeboren werden, wenn es einer Illusion gleicht?
(10) [Mādhyamika:] Auch eine Illusion entsteht, wenn die ursächlichen Bedingungen dafür zusammenkommen. Warum sollte allein die Tatsache, dass die Wesen über eine längere Zeit bestehen, der Beweis dafür sein, dass sie wahrhaft existieren?
(11) Ein Phantom hat kein Bewusstsein. Also entsteht, wenn man es tötet usw., kein Unrecht; denn Verdienst und Schuld entstehen nur aus Handlungen gegenüber einem [Wesen], das einen illusionären Geist besitzt.
(12) [Im Falle des Phantoms] entsteht kein illusionärer Geist, weil den Zaubersprüchen und den übrigen [Mitteln, mit denen der Zauberer die Illusion erzeugt,] dazu die nötige Wirkungskraft fehlt. So gibt es sogar verschiedene Arten von Illusionen, die aus den unterschiedlichen Bedingungen hervorgehen.
(13) Niemals ist eine einzige ursächliche Bedingung fähig, alles hervorzubringen. [Einwand: Wenn die Wesen sich] nach endgültiger Wahrheit im Nirvāṇa und nach konventioneller Wahrheit im Daseinskreislauf befinden,
(14) dann wäre selbst der Erwachte noch im Daseinskreislauf. Welchen Nutzen hätte also die Übung des Lebens zum Erwachen? [Mādhyamika:] Solange der Strom der ursächlichen Bedingungen nicht beendet wird, geht nicht einmal ein Trugbild zu Ende.
(15) Doch wenn die ursächlichen Umstände unterbrochen sind, entstehen [die saþsārischen Daseinszustände] nicht einmal als vorläufige Wirklichkeit. [Einwand Yogācārin:] Wenn nicht einmal das getäuschte [Bewusstsein] existiert, von wem wird dann die Illusion wahrgenommen?
(16) [Mādhyamika:] [Doch sagt erst:] Wenn für euch nicht einmal das Trugbild existiert, worauf ist dann das Bewusstsein gerichtet? [Yogācārin]: [In der Tat ist das Wahrnehmungsobjekt] in Wirklichkeit etwas anderes [als ein äußerer Gegenstand]. Es ist nämlich nur ein Bild in der Erscheinungsform des Objekts, das aber nichts anderes als der Geist selbst ist.
(17) [Mādhyamika:] Aber wenn der Geist selbst das [wahrgenommene] Trugbild ist, was wird dann von wem gesehen? Außerdem hat der Beschützer der Welt gelehrt, dass der Geist den Geist nicht sieht.
(18) Auch die Schwertklinge kann sich ja nicht selber schneiden. So [kann sich] auch die Wahrnehmung [nicht selbst wahrnehmen]. [Yogācārin: Das Bewusstsein braucht kein wirkliches äußeres Objekt. Es erschafft sich die Wahrnehmungen selbst], so wie das Lampenlicht sich selbst erhellt.
(19) [Mādhyamika:] Das Lampenlicht kann sich gar nicht selbst erhellen, weil es niemals von der Dunkelheit verhüllt war! [Yogācārin:] [Es ist vergleichbar mit einer von Natur her] blauen Substanz. Anders als beispielsweise ein [farbloses] Kristall muss sie nicht in Abhängigkeit von etwas anderem die blaue Farbe erst annehmen.
(20) So sieht man, dass einige Eigenschaften von etwas anderem abhängig sind, einige unabhängig. [Mādhyamika:] Aber auch hier hat sich nicht etwas selbst blau eingefärbt, das zuvor nicht blau war.
(21) Dass das Licht der Lampen etwas erhellt, sagt man, weil man dies mit einem Bewusstsein erkannt hat. Doch womit hat man jemals erkannt, dass das Gewahrsein die Eigenschaft des Erhellens besitzt, um dies als Tatsache behaupten zu können?
(22) Wenn es aber durch nichts erkannt wird, so ist es gleich, ob man es als erhellend oder als nicht-erhellend beschreibt; es ist ebenso sinnlos wie ein Gespräch über die Anmut der Tochter einer unfruchtbaren Frau.
(23) [Yogācārin:] Aber wenn es keine Eigenschaft [des Bewusstseins] ist, sich selbst wahrzunehmen, wie kann man sich dann an ein früheres Erlebnis erinnern? [Mādhyamika:] Die Erinnerung entsteht aus der Verbindung mit dem anderen, dem Erlebten, ähnlich wie im Fall des Rattengifts [, das in den Körper eingedrungen ist, aber erst später wirksam wird].
(24) [Yogācārin:] Wenn zusätzliche Bedingungen vorhanden sind, erkennt das Bewusstsein [sogar sehr weit entfernte und subtile Dinge]. Darum erhellt es sich selbst [in jedem Fall, da es sich selbst nahe ist]. [Mādhyamika: Das ist nicht schlüssig, denn] die Vase, die man durch das Auftragen einer magischen Augensalbe sieht, ist gewiss nicht die Zaubersalbe selbst! [Diese sieht man nicht, obwohl sie direkt auf dem Auge liegt].
(25) [Mādhyamika:] Das, was man sieht, hört oder weiß, soll hier nicht verneint werden; vielmehr wollen wir die Auffassung zurückweisen, mit der man [solche Bewusstseinsobjekte] für [absolut] wirklich hält, da sie die Ursache des Leidens ist.
(26) Ihr [Yogācārins] meint, das Trugbild unterscheide sich nicht vom Geist, aber die Position, dass es damit identisch ist, wollt ihr auch nicht einnehmen. Aber wenn er wirklich existiert, wie könnten sie dann verschieden sein? Sie seien identisch, sagt ihr dann. Aber dann ist er nicht wirklich.
(27) Wie [für euch] das Trugbild, obwohl es nicht wirklich [ein äußeres Objekt] ist, das Betrachtete ist, so ist [für uns] das [Bewusstsein] der Betrachter [, obgleich dieses ebenso unwirklich ist]. Ihr sagt, der Daseinskreislauf [‒ obwohl unwirklich ‒] habe immer etwas Wirkliches als Grundlage, anderenfalls sei er [wirkungslos] wie der Raum. [Daher müsse das Bewusstsein als Grundlage aller Erscheinungen wirklich sein].
(28) Doch wie kann etwas Unwirkliches dadurch wirksam werden, dass es auf etwas Wirklichem beruht? So wie ihr den Geist annehmt [‒ nämlich, dass er selbst wirklich sei, aber ohne ein wirkliches Objekt ‒], wäre er völlig isoliert, ohne jeden Begleitfaktor.
(29) Wenn der Geist frei wäre von erfassten [Objekten], so wären alle [Wesen] Vollendete. Was für einen Vorteil hätte es dann, davon zu reden, dass [alles Wahrgenommene] „nur Geist“ sei [, um damit das Hängen an den Objekten zu überwinden]?
(30) [Einwand:] Selbst wenn man erkannt hat, dass [die Dinge] einer Illusion gleichen, wie sollen dadurch die Leidenschaften beendet werden? Sogar bei dem [Zauberer], der das Trugbild einer Frau selbst geschaffen hat, entsteht das begehrliche Haften daran.
(31) [Mādhyamika:] Der Schöpfer [des Trugbilds] hat die Veranlagungen, die solche Leidenschaften gegenüber den Bewusstseinsobjekten entstehen lassen, nicht aufgegeben. Daher sind die Anlagen [für die Erkenntnis] der Leerheit zu schwach, wenn er die [Illusion der Frau] sieht.
(32) Indem man die Veranlagung zur Leerheit nährt, gibt man die Veranlagung zu wirklichen Dingen auf. Und indem man die Tendenz stärkt, dass gar nichts wirklich ist [auch nicht die Leerheit], lässt man auch jene [Tendenz zur Leerheit] los.
(33) Wenn das Denken auf kein Seiendes mehr gerichtet ist, dessen Existenz es hinterfragen müsste, wie könnte dann vor ihm das Nichtsein, dem jegliche Grundlage fehlt, Bestand haben?
(34) Wenn so weder das Sein noch das Nichtsein vor dem Denken bestehen bleiben, dann ist es ohne Bezugsobjekt, denn es gibt keine andere Möglichkeit. So findet es Ruhe.
(35) Wie ein wunscherfüllendes Juwel und ein wunscherfüllender Baum die Hoffnungen der Wesen erfüllt, so erscheint auch der Körper des Buddhas durch die Kraft [der Reinheit des Geistes] der Schüler und durch die Vorsätze [, die er noch als Bodhisattva gefasst hat].
(36) So wie zum Beispiel die Garuða-Säule weiterhin Gift und anderes unschädlich macht, obwohl schon lange Zeit verstrichen ist, seit sie [von dem Schlangenbeschwörer] geweiht wurde,
(37) so erwirkt auch der Buddha alle Heilsziele [der Wesen], obwohl [er als] Bodhisattva aus der leidhaften Welt verloschen ist ‒ gleichsam wie eine Säule, die geweiht ist, weil sie durch [seinen] Lebenswandel zum Erwachen geformt wurde.
(38) [Einwand:] Aber wie sollte eine Verehrung Früchte hervorbringen, die man einem [Wesen] ohne Geist erwiesen hat? [Mādhyamika:] Weil [in der Überlieferung] erklärt wird, dass [das Verdienst] gleich ist, ob [der Buddha] nun verweilt oder ins Nirvāṇa eingegangen ist.
(39) Aus der Überlieferung wird klar, dass die Frucht entsteht, ganz gleich, ob [man den Buddha für] konventionell oder für endgültig [existent hält]. Sie entsteht genauso wie zum Beispiel in [eurem] Fall, wenn [ihr] den [als] wirklich [angenommenen] Buddha [verehrt].
(40) [Anhänger des Śrāvakayāna:] Aus der Erkenntnis der [Vier] Wahrheiten ergibt sich die Befreiung; wozu soll die Schau der Leerheit nützen? [Mādhyamika:] Weil in den Schriften gelehrt wird, dass es das Erwachen ohne diesen Pfad nicht gibt.
(41) [Gegner: Aber] das Mahāyāna ist keine authentische [Lehre des Buddhas]. [Mādhyamika:] Aber wodurch ist denn eure Überlieferung gesichert? [Gegner:] Weil ihre Gültigkeit für uns beide erwiesen ist. [Mādhyamika:] Aber davor war sie für euch auch nicht gültig!
(42) Der gleiche Umstand, der euch die Überzeugung von der Glaubwürdigkeit eurer Überlieferung verschafft, gilt auch für das Mahāyāna. Wenn [ihr] überdies [sagt, eure Überlieferung] sei wahr, weil sie von zwei verschiedenen [Schulen] anerkannt wird, so folgt daraus, dass auch die Veden und andere [nicht-buddhistische] Schriften wahr sind.
(43) [Gegner:] Das Mahāyāna [ist keine glaubwürdige Überlieferung], weil es darüber Streit gibt. [Antwort:] Dann müsste [auch eure] Überliefung [aus dem gleichen Grund] verworfen werden. Denn auch sie ist Gegenstand des Streits, da es über diese Überlieferung Streit mit den nicht-buddhistischen Traditionen gibt. Ebenso gibt es Meinungsverschiedenheiten über die diversen Überlieferungen [in der Tradition des Śrāvakayāna] sowohl mit eurer eigenen als auch mit anderen [Schulen].
(44) Die Wurzel der Lehre ist der Zustand des Bettelmönchs, doch eben diese Ebene des Bettelmönchs ist schwer zu erreichen. Folglich ist auch das Nirvāna unmöglich für jene [zu erreichen], deren Geist noch mit einem Wahrnehmungsobjekt verbunden ist.
(45) Ergäbe sich die Befreiung aus dem Aufgeben der Leidenschaften, so müsste die Befreiung unmittelbar danach eintreten. Und doch weiß man, dass es bei jenen [, die das Ende der Leidenschaften erfahren haben,] weiterhin eine Wirkungskraft von Taten gibt, obwohl sie ohne Leidenschaften sind.
(46) [Gegner:] Der einmal erreichte Zustand, in dem das Verlangen als eine wesentliche Ursache für eine folgende Wiedergeburt nicht mehr besteht, ist endgültig. [Antwort:] Aber selbst wenn dieses Verlangen nicht mehr mit Leidenschaften einhergeht, warum sollte es nicht als fundamentale Unwissenheit weiterbestehen?
(47) [Denn] das Verlangen entsteht aus dem Umstand der Empfindung, und Empfindungen gibt es bei jenen auch weiterhin. Bewusstein, das auf Bezugsobjekte gerichtet ist, bleibt bei ihnen [somit] weiter bestehen.
(48) Ohne die [Erkenntnis der] Leerheit kehrt [daher auch] das [mit Leidenschaften einhergehende] Bewusstsein, das [vorübergehend] unterbunden ist, wieder zurück, wie im Falle der tiefen Versenkung der Unterscheidungslosigkeit. Deshalb soll man die Leerheit meditieren.
(49) Ihr betrachtet solche Aussagen, die sich auf die Sammlung der Sūtras beziehen, als Lehren des Buddhas. Warum akzeptiert ihr dann nicht auch, dass der größte Teil des Mahāyāna mit den von euch akzeptierten Sūtras übereinstimmt?41
(50) Wenn ihr das ganze [Mahāyāna] insgesamt für fehlerhaft haltet, nur weil [eurer Meinung nach] ein Teil davon nicht zu [dem Wort des Buddhas] gehört, warum [aktzeptiert ihr] dann nicht auch, dass das ganze [Mahāyāna] von dem Siegreichen gelehrt wurde, sobald eine einzige [Lehre daraus] den [von euch anerkannten] Sūtras entspricht?
(51) Wer sollte eine Lehre [des Buddhas], die von Mahākāśyapa und anderen [Arhats] nicht in ihrer Tiefe ergründet wurde, verwerfen, nur weil ihr sie nicht versteht?
(52) Um der [Lebewesen] willen, die aufgrund ihrer Unwissenheit leiden, verweilen [die Bodhisattvas] wirkend im Daseinskreislauf, befreit von den Extremen der Anhaftung und der Furcht. Dies ist die Frucht der [Erkenntnis der] Leerheit.
(53) Die Einwände, die gegen die Leerheit vorgebracht werden, sind nicht begründet. Deshalb soll man die Leerheit meditieren, ohne Zweifel zu hegen.
(54) Die Leerheit ist das Gegenmittel gegen die Dunkelheit der Hindernisse durch Leidenschaften und der Hindernisse für die Allwissenheit. Warum nur wird sie von jenem, der schnell die Allwissenheit [zu verwirklichen] wünscht, nicht geübt?
(55) Furcht mag entstehen vor Dingen, die Leiden hervorbringen; warum aber sollte Furcht vor der Leerheit entstehen, die doch das Leiden beendet?
(56) Falls es irgendein Selbst gibt, mag man sich vor allem Möglichen fürchten; doch da es kein Selbst gibt, wer sollte sich da fürchten?
(57) [Verneinung des Selbst:] Die Zähne, die Haare und die Nägel sind nicht das Selbst. Das Selbst sind nicht die Knochen und nicht das Blut, nicht der Rotz, nicht der Schleim und auch Sekrete oder Eiter sind es nicht.
(58) Das Selbst ist weder das Fett noch der Schweiß; auch die Lunge oder die Leber sind nicht das Selbst. Noch ist irgendeines der anderen inneren Organe das Selbst; das Selbst ist nicht Kot noch Urin.
(59) Nicht Fleisch noch Haut sind das Selbst; auch sind weder Hitze noch Winde das Selbst. Die Körperhöhlungen sind nicht das Selbst. Auch die sechs Bewusstseinsarten sind in keiner Weise das Selbst.
(60) [Das Selbst ist keine bewusste, unverändliche Seele ‒ gegen die Sāṃkhyas:] Wenn die HörWahrnehmung [eine Eigenschaft des von euch] beständig [angenommenen Selbst] wäre, so müsste man zu allen Zeiten den Ton erfassen. Wenn es aber kein Wahrnehmungsobjekt hat, was bleibt dann als Erkanntes, das die Bezeichnung „Bewusstsein“ rechtfertigte?
(61) Wenn etwas ohne Gewahrsein [eines Objekts] Bewusstsein wäre, dann könnte auch ein Stück Holz Bewusstsein sein. Deshalb steht fest: Es gibt kein Bewusstsein ohne ein damit verbundenes Bewusstseinsobjekt.
(62) Ihr sagt, es sei dasselbe [Bewusstsein, das zuvor die Töne wahrgenommen hat], welches [jetzt] das Sichtbare wahrnehme. Aber wenn es dasselbe ist, warum ist es dann nicht auch zur Zeit [des Sehens] ein hörendes [Bewusstsein]? Ihr sagt, weil es nicht mehr mit einem Ton in Verbindung steht. Aber aus eben diesem Grund besteht das [Hör-]Bewusstsein jetzt nicht mehr.
(63) Wie sollte etwas, dessen Wesen im Erfassen von Tönen besteht, zu einer Wahrnehmung von Sichtbarem werden? Zwar kann derselbe [Mensch] begrifflich als Vater und als Sohn aufgefasst werden, aber er ist dies beides nicht der Wirklichkeit nach.
(64) Denn [sein eigentliches Wesen ist eurer Meinung nach die Grundnatur, bestehend aus den drei Konstituenten (guṇa):] Lebensenergie (sattva), Partikel (rajas) und Dunkelheit (tamas), und diese Grundnatur ist weder Sohn noch Vater. So lässt sich nicht erkennen, wie jene [Wahrnehmung von sichtbaren Körpern gleichzeitig] die Natur der Wahrnehmung von Tönen haben sollte.
(65) Sagt ihr, diese [Natur] ließe sich [weiterhin] erkennen, weil [das Bewusstsein] ‒ gleich einem Schauspieler ‒ [nur] einen anderen Zustand angenommen habe, so ist [euer beständiges, bewusstes Selbst tatsächlich] unbeständig. Wenn ihr etwas für dasselbe haltet, was sich in seinem Zustand geändert hat, so ist das allerdings eine völlig neue, noch nie dagewesene Art der Identität!
(66) Ihr sagt, die verschiedenen Einzelzustände [des bewussten Selbst] seien nicht [seine] wahre [Natur]. Aber so nennt doch einmal die [wahre] Natur! Wenn ihr meint, sie bestehe in dem Bewusstsein [an sich], so folgt absurderweise, dass alle Menschen eins sind.
(67) Überdies wären alle bewussten Wesen und alle unbewussten Dinge dasselbe. Warum? Weil sie sich darin gleichen zu existieren. Wenn die Unterschiede eine Einbildung sind, auf welcher Basis kann es dann eine Gleichheit [von Einzeldingen] geben?
(68) [Das Ich ist kein unbewusstes Selbst ‒ gegen die Vaiśeṣikas:] Auch etwas Nicht-Geistiges kann nicht das Selbst sein, eben weil es ohne Geist ist, wie eine Vase und dergleichen. Wenn ihr sagt, es sei dadurch bewusst, dass es mit Geist verbunden ist, so ist [eure Position, das Selbst sei] unbewusst, hinfällig.
(69) Wenn das Selbst unveränderlich wäre, was sollte ihm dann das Bewusstsein nützen? Dann soll man doch gleich behaupten, der unbewusste und wirkungslose Raum sei das Selbst.
(70) Ihr [Vertreter eines beständigen Selbst] sagt: Wenn es das Selbst nicht gibt, so ist die Verbindung von Tat und Frucht nicht begründet; denn wessen Tat sollte sie noch sein, wenn der Handelnde, nachdem er sie ausgeführt hat, nicht mehr existiert?
(71) [Antwort:] Es ist doch für uns beide erwiesen, dass Handlung und Wirkung verschiedene [Lebensabschnitte oder Existenzen] als Grundlage haben und dass zu jener [Zeit, da die Frucht erfahren wird,] das handelnde Selbst nicht existiert [‒ ihr, weil für euch das Selbst in sich beständig und damit untätig ist, wir, weil wir ein wirkliches Selbst gar nicht annehmen]. Ist dann dieser Streit nicht grundlos?
(72) „Jener, der die Ursache geschaffen hat, der kommt auch mit der Wirkung zusammen.“ ‒ Dieser Fall ist unmöglich zu sehen. Dass der Täter auch der ist, der [die Früchte] erlebt, wurde nur im Hinblick auf dasselbe Kontinuum gelehrt [, das sie verbindet].
(73) Der vergangene und der zukünftige Geist sind nicht das Selbst; denn sie bestehen nicht. [Sagt man] aber, der gerade entstandene Geist sei das Selbst, so gibt es wieder kein Selbst, wenn er vergangen ist.
(74) Wie da nichts vorzufinden ist, wenn man die Stämme von Bananenstauden in ihre Teile zerlegt, so ist auch das Selbst nicht wirklich, wenn es kritisch geprüft wird.
(75) Ihr fragt, mit wem man Mitgefühl üben soll, wenn es ein fühlendes Wesen nicht gibt? Mit jenem [Wesen], das eine Zuschreibung durch den Irrtum ist, dem [sich der Bodhisattva] um des Resultates willen anschließt.
(76) „Aber wenn es kein Lebewesen gibt, wem sollte dann das Resultat [des Mitgefühls] zu eigen sein?“ ‒ Sehr richtig! Doch wir akzeptieren [die Übung des Mitgefühls] auf der Grundlage des Irrtums [, welcher der Konvention innewohnt]. Weil das Ziel ist, das Leiden vollständig zu beenden, lehnen wir diese Täuschung über das Resultat nicht ab.
(77) Der Ich-Stolz, der die Ursache des Leidens ist, wächst dagegen durch den Irrtum über das Selbst an. Und wenn man meint, dass er gerade aufgrund des Irrtums nicht überwunden werden kann, so ist die Meditation über das Nicht-Selbst das Beste.
(78) [Die Vergegenwärtigung des Körpers:] Weder die Füße noch die Unterschenkel sind der Körper; auch sind nicht die Oberschenkel oder die Hüften der Körper; ebenso sind weder Bauch noch Rücken der Körper; und auch die Brust und die Oberarme sind nicht der Körper;
(79) weder sind die Seiten noch die Hände der Körper; weder sind es die Achseln, noch die Schultern; auch die inneren Organe sind nicht der Körper, noch sind es der Kopf und der Hals. Was von diesen [Teilen] ist also der Körper?
(80) Wenn sich der Körper zu jeweils einem Teil in jedem dieser [Körperteile] befände, gut, dann befänden sich seine Teile in den Teilen, aber wo befindet er sich selbst?
(81) Doch wenn sich der Körper als Ganzes in den Händen und den übrigen [Gliedern] befände, so müsste es ebenso viele Körper geben, wie es Hände und andere [Körperteile] gibt.
(82) Der Körper befindet sich weder außen noch innen. Wie sollte er also in den Händen und den anderen Teilen vorhanden sein? Auch ist er von den Händen und den übrigen Teilen nicht getrennt. Wie soll er nun existieren?
(83) Den Körper gibt es also nicht, [aber] durch den Irrtum entsteht die Auffassung von einem Körper in Bezug auf die Hände und die übrigen Körperteile aufgrund ihrer besonderen Anordnung zu einer bestimmten Gestalt ‒ so wie in Bezug auf eine Skulptur aus Steinen die Wahrnehmung entsteht, dort wäre ein Mensch.
(84) Solange die Bedingungen vollständig sind, erscheint die Gestalt [einer Skulptur] als Mensch. Ebenso nimmt man, solange die Glieder – die Hände und so weiter – bestehen, diese als Körper wahr.
(85) Und was bleibt als Hand, wenn sie [nur] ein Komplex von Fingern ist? [Und was ist] der Finger, ist er doch auch nur eine Ansammlung von Gliedern? [Und was ist] das Glied, da es sich ja in seine eigenen Bestandteile unterteilt?
(86) [Und was ist] jener Teil, wo er doch aus Atomen besteht? [Und was ist] das Atom, wenn es doch aus Richtungsabschnitten besteht? Der einzelne Richtungsabschnitt aber hat keine weiteren Bestandteile, gleich dem leeren Raum, und so gibt es auch kein [wirkliches] Atom.
(87) Welcher Vernunftbegabte würde also an einer solchen traumgleichen Gestalt haften? Wenn es somit keinen Körper gibt, was ist dann ein Mann, und was ist eine Frau?
(88) [Vergegenwärtigung der Empfindungen:] Wenn der Schmerz in Wirklichkeit besteht, warum quält er dann nicht jenen, der sich freut? Und wenn die Lust [wirklich ist], warum beglückt sie dann mit einem wohlschmeckenden Mahl nicht den Menschen, der von Kummer erfüllt ist?
(89) [Gegner:] Die eine [Empfindung] wird nicht mehr gespürt, weil sie nun von einer stärkeren überstrahlt wird. [Mādhyamika:] Aber wie kann sie Empfindung sein, wenn ihre Natur nicht darin besteht, dass man sie fühlt?
(90) [Gegner:] [Wenn die Freude erlebt wird,] existiert das Leiden in einer subtilen Form weiter. Die grobe [Leidensempfindung] wird [von dem starken Glücksgefühl] zurückgedrängt, so dass sie nicht mehr offenbar ist. Die [Leidensempfindung] besteht dann in einer von [dem starken manifesten Glück] abweichenden, kaum wahrnehmbaren Freude weiter. [Mādhyamika:] In dem Fall wäre genau diese subtile [Empfindung] von der [gleichen Art] wie jene [Glücksempfindung, und deshalb wäre sie kein Leiden].
(91) Ist denn durch die Tatsache, dass Leiden nicht aufkommt, wenn es durch das Entstehen gegensätzlicher Umstände verhindert wird, nicht bewiesen, dass die „Empfindung“ nichts weiter ist als das Festhalten an einem Begriff?
(92) Aus eben diesem Grund macht man sich als Gegenmittel für diese [Neigung] mit solchen Untersuchungen vertraut; denn die meditativen Versenkungen, die auf dem Feld der rechten Überlegungen wachsen, sind die Nahrung der Yogis.
(93) [Wenn es zwischen Objekt und Sinnesvermögen einen Abstand gibt, wie sollen sich diese dann verbinden [, damit aus der Berührung die Empfindung entsteht]? Wenn aber nichts dazwischen liegt, sind sie ein und dasselbe, und was sollte sich dann womit verbinden?
(94) Ein Atom kann nicht in ein anderes Atom eindringen; denn sie sind homogen und gleichförmig. Ohne Durchdringung aber gibt es keine Verschmelzung, und ohne Verschmelzung gibt es keine Verbindung.
(95) Wie könnte die Annahme gültig sein, dass eine Verbindung auch von Teilelosem möglich ist? Solltet ihr eine Verbindung sehen, bei der sich Teileloses zusammenfügt, dann weist sie nach!
(96) Für das unkörperliche Bewusstsein ist eine Verbindung [mit dem körperlichen Objekt] schlechthin unmöglich; das Gleiche gilt für etwas Zusammengesetztes, weil es keine Wirklichkeit hat, wie zuvor schon untersucht wurde.
(97) Woraus aber sollte die Empfindung entstehen, wenn es in der Weise keine Berührung gibt? Welchen Sinn hat dann die Mühsal? Wodurch könnte denn wem Leiden zugefügt werden?
(98) Wenn es weder einen Empfindenden noch die Empfindung gibt, warum, Verlangen, vergehst du dann nicht, nachdem du diese Tatsache erkannt hast?
(99) Was man sieht oder was man berührt, hat eine traumgleiche und illusionsgleiche Natur. Daher ist auch die Empfindung nicht wirklich. [Zudem] wird sie, weil sie gleichzeitig mit dem Bewusstsein entsteht, von diesem nicht wahrgenommen.
(100) Und auch ein zuvor oder später entstandenes [Bewusstsein] erlebt sie nicht, sondern denkt nur an sie. Sie erlebt sich auch nicht selbst, und sie wird auch nicht von anderen [Bewusstseinszuständen] erfahren.
(101) Auch gibt es kein empfindendes [Subjekt]. Daher ist die Empfindung nicht wirklich. Wem bereitet sie Leiden, wenn es in diesem Bündel [körperlicher und geistiger Faktoren] kein Ich gibt?
(102) [Vergegenwärtigung des Geistes:] Das Wahrnehmen wohnt weder in den Sinnesorganen, noch in den sichtbaren oder anderen Objekten, noch dazwischen. Der Geist ist weder innen noch außen, noch findet man ihn anderswo.
(103) Was weder im Körper ist, noch außerhalb, noch sowohl innen wie außen, und auch nicht getrennt für sich besteht, das ist gar nichts. Deshalb befinden sich die Wesen von Natur her im Nirvāṇa.
(104) Wenn die Wahrnehmung früher stattfindet als das Wahrnehmungsobjekt, worauf ist sie dann gerichtet, wenn sie entsteht? Wenn die Wahrnehmung mit dem Wahrnehmungsobjekt gleichzeitig geschieht, worauf ist sie dann gerichtet, wenn sie entsteht?
(105.ab) Und wenn die Wahrnehmung erst nach dem Wahrnehmungsobjekt existiert, woraus entsteht sie dann?
(105.cd) [Vergegenwärtigung der Phänomene:] In dieser Weise [untersucht,] ist bei allen Phänomenen ein Entstehen nicht erkennbar.
(106) [Einwand:] Wenn es sich so verhält, dann gibt es nicht einmal konventionelle [Existenz]. Wie kann es dann die zwei Wahrheiten geben? Und wenn jene [Existenz allein] von einem anderen konventionellen, getäuschten [Denken] bestimmt wird, wie kann dann ein Wesen jemals die Befreiung vom Leiden im Nirvāṇa erreichen?
(107) [Antwort:] Dies ist das verblendete Denken eines anderen Geistes, nicht das eigene konventionelle [Denken der Person, die das Nirvāṇa erreicht hat]. Würde [auch] nach [dem Nirvāṇa] noch ein solches festgestellt, so bestünde die [Täuschung der] Konvention [tatsächlich weiter]; doch weil das nicht der Fall ist, ist es eine Tatsache, dass sie nicht mehr existiert.
(108) Das Denken und das Gedachte sind voneinander abhängig. Jede kritische Untersuchung trifft ihre Aussagen in Abhängigkeit von dem, was allgemein bekannt ist.
(109) [Einwand:] Wenn man aber mit kritischer Untersuchung das analysiert, was zu überprüfen ist, so muss auch diese kritische Untersuchung selbst wieder einer Überprüfung unterzogen werden. So kommt man nie zu einem Ende.
(110) [Antwort:] Wenn das, was kritisch zu prüfen ist, geprüft wurde, dann hat die Kritik keine Basis mehr. Weil sie keine Basis hat, entsteht sie nicht, und das nennen wir Nirvāṇa.
(111) Wer aber diese beiden [‒ Objekt und Bewusstsein ‒] für [absolut] wirklich hält, der befindet sich in einer besonders misslichen Lage: Meint er, dass das Objekt sich kraft der Erkenntnis ergibt, dann ist die Frage, was die Basis für die Entstehung der Erkenntnis ist.
(112) Meint er aber, dass sich das Bewusstsein aus dem Bewusstseinsobjekt ergibt, dann ist die Frage, worauf sich die Existenz des Bewusstseinsobjekts gründet. Oder er meint, dass sie gegenseitig ihre Existenz begründen; dann aber folgt, dass sie beide nicht [ihrem Eigenwesen nach] existieren.
(113) Aus wem kann der Sohn entstanden sein, wenn es ohne Sohn keinen Vater gibt? Ohne Sohn existiert der Vater nicht. Genauso bestehen auch [Objekt und Bewusstsein] nicht [für sich].
(114) [Einwand:] Der Spross entsteht aus dem Samen, also weiß man [von der Existenz des] Samens aufgrund eben dieses [Sprosses]. Warum sollte man nicht in der gleichen Weise aufgrund des Bewusstseins, das aus einem Bewusstseinsobjekt entstanden ist, auf die Existenz des [Objekts] schließen?
(115) [Antwort:] Die Wahrnehmung des Sprosses, aus der sich das Wissen von der Existenz des Samens ableitet, ist ein von dem Spross verschiedenes Bewusstsein. Aber woraus lässt sich die Existenz eines Bewusstseins erschließen, aus dem man [die Existenz] des Bewusstseinsobjekts ableiten könnte?
(116) [Verneinung des Entstehens ohne Ursache:] Häufig erkennt schon die Welt mit unmittelbarer Wahrnehmung, dass es eine Vielzahl von Ursachen gibt. So ist die Vielfalt eines Lotos wie der Stengel und so fort von einer Vielfalt von Ursachen hervorgebracht worden.
(117) Wodurch aber wurden die vielfältigen Ursachen geschaffen? Durch die vielfältigen Ursachen, die ihnen vorausgingen. Und woher haben die Ursachen die Kraft, die Wirkung zu erzeugen? Von der Wirkungskraft der vorhergehenden Ursachen.
(118) [Verneinung des Entstehens aus einer ewigen Ursache:] Wenn [der Gott] Īśvara der Schöpfer der Lebewesen ist, dann erklärt uns einmal: Was ist dieser Īśvara? Ihr sagt, er bestehe aus den Elementen. Gut, das mag so sein ‒ aber warum dann all die Mühe wegen eines bloßen Namens?
(119) Zudem sind die Erde und die übrigen [Elemente] aus vielen [Teilen] bestehend, unbeständig, inaktiv und nicht göttlich, man tritt auf sie, und sie sind unrein. Deshalb sind sie unmöglich Īśvara.
(120) Īśvara ist nicht der Raum, denn der ist inaktiv. Er ist nicht das Selbst, denn dieses ist zuvor bereits widerlegt worden. Und auch ein „unbegreiflicher“ Schöpfer [ist er nicht]; [denn] welchen Sinn sollte es haben, das Unbegreifliche zu beschreiben?
(121) Und was ist es, das er beabsichtigt zu erschaffen? Sind denn [nach eurer Auffassung] das Selbst, die Erde und die übrigen [Elemente] sowie Īśvara selbst in ihrem Wesen nicht beständig [und somit frei von Verursachung]? Bewusstsein aber entsteht aus Bewusstseinsobjekten und
(122) ist anfangslos. Glück und Leiden entstehen aus Taten. Sagt also, was wird von ihm erzeugt? Wenn die Ursache ohne Anfang ist, wie könnte es einen Anfang der Wirkung geben?
(123) Warum erschafft er nicht immerdar, da er ja von nichts anderem abhängig ist? Wenn es nichts gibt, das er nicht selbst geschaffen hätte, wovon sollte [sein Schaffen] dann abhängig sein?
(124) Wenn [sein Schaffen] aber [von anderen Bedingungen] abhängig ist, dann ist eben dieses Zusammentreffen [der Bedingungen] die Ursache und nicht Īśvara. Wenn [die Ursachen] zusammenkommen, hat er nicht die Macht, das Entstehen zu verhindern, und ohne dass diese zusammentreffen, hat er keine Macht, das Entstehen zu bewirken.
(125) Wenn Īśvara erschafft, ohne es zu wollen, so folgt absurderweise, dass er unter der Macht von anderem steht. Wenn er es aber will, so folgt, dass er von seinem Willen abhängig ist. Wie kann er also, selbst wenn er erschafft, ein allmächtiger Schöpfergott sein?
(126.ab) Auch jene, die beständige Atome vertreten, sind zuvor schon widerlegt worden.
(126.cd) [Verneinung des Entstehens aus einer ewigen Urmaterie:] Die Sāþkhya-Philosophen meinen, eine beständige Grundnatur sei die Ursache der Welt.
(127) Die „Urmaterie“ beschreiben sie als einen Zustand des Gleichgewichts von [drei] Konstituenten (guṇa): der „Lebensenergie“ (sattva), der „Partikel“ (rajas) und der „Dunkelheit“ (tamas); und die Welt der Lebewesen sehen sie als ein Ungleichgewicht dieser drei an.
(128) Es ist unhaltbar, dass eine teilelose [Entität] drei Naturen hat. Daher gibt es [die Urmaterie] nicht. Ebenso gibt es ihre [drei] Konstituenten nicht, denn auch sie sind jeweils dreifach.
(129) Wenn es aber die Konstituenten nicht gibt, rückt auch die Existenz von Tönen und der übrigen [Umgestaltungen der Urmaterie] in weite Ferne. Ebenso können in Unbewusstem wie Kleidung usw. unmöglich solche [Konstituenten] wie Glück vorhanden sein.
(130) [Sāþkhya]: Die [entstehenden] Dinge haben das [beständige] Wesen [ihrer] Ursachen [und nehmen nur andere, wandelnde Erscheinungsformen an]. [Mādhyamika:] Aber haben wir die Dinge nicht schon kritisiert? Zudem ist für euch die Ursache [der Sinnesobjekte] die Lust [‒ d.h. Lebensenergie ‒] und die übrigen [Konstituenten der Urmaterie], aber daraus entstehen gewiss kein Wollstoff und ähnliche Dinge.
(131) [Empfindungen von] Glück usw. entstehen aus dem Wollstoff und den anderen [Sinnesobjekten]; fehlen diese, gibt es einen Mangel an Glück oder anderen [Empfindungen]. Außerdem hat man niemals Glück beobachtet, das beständig wäre.
(132) Wenn das Glück [und die übrigen Konstituenten stets] in manifester Form vorhanden sind, warum empfindet man sie dann nicht [immer]? Ihr sagt, weil das Glück subtil geworden sei [, wenn etwa das Leiden dominiert]. Aber wie kann es [erst] grob sein und [dann] subtil?
(133) Wenn es nach Beendigung des groben Zustands subtil wird, folgt, dass subtil und grob unbeständig sind. Warum akzeptiert ihr dann nicht genauso die Unbeständigkeit aller Dinge?
(134) Wenn der grobe Zustand [des Glücks] nichts anderes als das Glück ist, dann ist die Unbeständigkeit des Glücks klar. Ihr behauptet, etwas Nichtexistentes könne nicht entstehen, weil es [eben] nicht existiere.
(135) Doch dass ein manifester Zustand [etwa von Glück] entsteht, der [zuvor] nicht existierte, ist [selbst in eurem System] vorhanden, obwohl ihr es nicht akzeptiert. Wenn die Wirkung schon in der Ursache vorhanden wäre, dann würde einer, der eine Speise isst, die Exkremente essen.
(136) Und dann kauft doch für den Preis des Stoffes den Baumwollsamen und kleidet euch damit! Ihr sagt, die Welt sehe aus Verblendung nicht [, dass die Wirkung schon in der Ursache vorhanden ist]. Aber auch ein [Yogi], der die Wirklichkeit erkennt, verhält sich genauso.
(137) Zudem müsste auch die Erkenntnis [des Yogi schon] in den Weltmenschen vorhanden sein. Warum sehen sie es dann nicht? Ihr sagt, weil der Weltmensch nicht maßgeblich ist. Aber dann wäre sogar seine Wahrnehmung der manifesten [Objekte] unwahr.
(138) [Sāþkhya:] Wenn [aber in eurem Mādhyamika-System] eine gültige Erkenntnis keine gültige Erkenntnis ist, ist dann das von ihr Erkannte nicht [ebenso] unwahr? Dann aber folgt, dass die Meditation über die Leerheit unsinnig ist.
(139) [Mādhyamika:] Ohne auf das [irrtümlich als wirklich] vorgestellte Seiende Bezug zu nehmen, kann man dessen Nichtsein nicht erfassen. Deshalb ist das Nichtsein eines falschen Seienden ohne Frage ebenso falsch wie dieses selbst. [Folglich ist auch die Leerheit nicht absolut.]
(140) Wenn der Sohn im Traum stirbt, dann verhindert die Vorstellung, dass er nicht mehr existiert, die Vorstellung, dass er vorhanden ist; und dabei ist eine ebenso irreal wie die andere.
(141) [Zusammenfassung der Verneinung des wahren Entstehens:] Wenn man in dieser Weise untersucht, gibt es daher nichts, das ohne Ursachen wäre; ebenso ist nichts in den einzelnen oder in der Vereinigung der Umstände vorhanden; (142) nichts ist von anderswo her gekommen; nichts bleibt; nichts geht fort. Worin unterscheidet sich das, was aus Verblendung zur wahren Wirklichkeit erhoben wird, von einer Illusion?
(143) [Das Argument des Abhängigen Entstehens:] Untersuche doch jene Erscheinungen, die der Zauberer geschaffen hat, und jene, die von [ihren] Ursachen geschaffen wurden: Woher kommen sie, und wohin gehen sie?
(144) [Ein Ding,] das durch die Gegenwart der [bedingenden Faktoren] sichtbar wird, aber nicht [zu sehen ist], wenn jene fehlen, besteht [nur] künstlich. Wie sollte es, einem Spiegelbild gleich, eine wahre Wirklichkeit besitzen?
(145) [Das Argument, dass weder existente noch nicht-existente Wirkungen entstehen:] Welchen Sinn hätten Ursachen, um ein Seiendes [hervorzubringen], das bereits existiert? Und welchen Sinn hätten Ursachen, wenn es [absolut] nicht-existent ist?
(146) Auch durch Milliarden Ursachen kann etwas Nichtseiendes nicht umgewandelt werden. Wie könnte das [noch zu entstehende] Seiende in diesem Zustand [des Nichtseienden] bestehen? Und was anderes [als ein Nichtseiendes] kann zum Seienden werden?
(147) Wenn das Seiende aber zur Zeit seines Nichtseins nicht besteht, wann wird dann [jemals] das Seiende entstehen? Denn solange es nicht entstanden ist, hört sein Nichtsein ja nicht auf.
(148) Solange aber das Nichtsein nicht aufgehört hat, hat das Seiende keine Möglichkeit zu sein. Oder das Seiende müsste auch den Zustand des Nichtseins annehmen, aber daraus folgte absurderweise, dass es zwei Naturen hätte.
(149) So gibt es weder Vernichtung noch Sein. Deshalb ist diese ganze Welt der Lebewesen niemals entstanden und wird niemals vergehen.
(150) Einem Traum gleicht die Welt; denn wenn man [die Gegebenheiten] untersucht, sind sie wie die Bananenstaude [ohne Wesenskern]. In Wirklichkeit gibt es keinen Unterschied zwischen dem erlösten Zustand des Nirvāṇa und dem nicht-erlösten Zustand des Nicht-Nirvāṇa.
(151) [Fazit und Abschluss:] In dieser Weise sind alle Dinge leer; was gibt es da zu gewinnen, was zu verlieren? Von wem gibt es welche Ehrbezeugung, welche Schmähung?
(152) Woraus sollten Glück oder Leiden [entstehen]? Was gibt es zu lieben, was zu hassen? Wenn man in der Wirklichkeit sucht, wer begehrt, und was wird begehrt?
(153) Wenn man sie ergründet, was ist dann diese Welt der Lebenden? Wer stirbt? Wer wird geboren werden? Wer hat gelebt? Wer ist Verwandter, wer ist Freund?
(154) Mögen jene, die wie ich [die Wirklichkeit ergründen], alles so [leer] betrachten wie den Raum. Jene, die für sich selbst nach Glück verlangen, erbosen sich durch Streitigkeiten und entzücken sich an Vergnügungen.
(155) Mit üblen Taten und unter großen Mühen verbringen sie ihr Leben in Kummer, Anstrengung, Streit, gegenseitigen Verletzungen und Verstümmelungen.
(156) Und immer wieder haben sie glückliche Daseinsformen erreicht, wo sie sich Tag für Tag dem Genuss von vielerlei Freuden hingegeben haben, um dann, nachdem sie dort gestorben sind, in die niedrigen Bereiche zu fallen, mit lang andauernden, schrecklichen Leiden.
(157) Zahlreich sind die Abgründe im weltlichen Dasein, und es herrscht dort die Unwirklichkeit. Wegen des gegenseitigen Widerspruchs [zwischen Schein und Wirklichkeit] kann [daher] im weltlichen Dasein eine Wirklichkeit wie diese [hier beschriebene] nicht vorkommen.
(158) Deshalb ist der [Kreislauf des Daseins] ein endloser Ozean von schrecklichen, unvergleichlichen Leiden. So sind dort die Kräfte [zum Heilsamen] gering, und das Leben ist wahrlich kurz.
(159) Da geht unter Arbeit für Leben und Gesundheit, unter Hunger, Erschöpfung, Schlaf, Verletzungen, unter sinnloser Gemeinschaft mit den Toren (160) das Leben rasch und nutzlos dahin. Dabei ist die unterscheidende Erkenntnis kaum zu gewinnen. Kann man denn auch dort, wo die Ablenkung vertraut ist, ein Gegenmittel finden?
(161) Dort versucht Māra, uns in die großen Leidensbereiche zu stürzen. Da sind die falschen Wege zahlreich, und der Zweifel ist kaum zu bezwingen.
(162) Es ist schwierig, wieder Muße zu finden, und äußerst selten, auf einen Buddha zu treffen. Der Fluss der Leidenschaften ist schwer einzudämmen. Ach, so setzt sich das Leiden ohne Unterlass fort.
(163) Und trotz des Leidens sehen sie ihr eigenes Leiden nicht. Ach, wie traurig ist der Anblick dieser Wesen, die sich in einem Strom des Leidens befinden!
(164) So wie ein [Verwirrter] sich immer wieder [in kaltem Wasser] badet, um dann wieder ins Feuer zu springen, glauben die Verblendeten, die in Wahrheit im Leiden leben, sie lebten im Glück.
(165) Dort wo sie leben, als gäbe es weder Altern noch Tod, wartet auf sie zuerst der Tod und dann der grausame Fall in ein schlechtes Dasein.
(166) Wann nur werde ich imstande sein, mit dem Regen der Glücksgüter, der aus den Wolken meiner eigenen Verdienste entstanden ist, ihnen Frieden zu bringen, die so vom Feuer des Leidens gepeinigt werden?
(167) Wann nur werde ich imstande sein, auf die Weise des Nichtwahrnehmens hingebungsvoll die Fülle an guten Werken zu erwerben, mit der ich jene die Leerheit zu lehren vermag, die durch Wahrnehmung ins Unheil geraten sind?
10. Widmung
(1) Mögen alle Wesen durch das Heilsame, das vom Nachdenken über den Eintritt in den Weg zum Erwachen entstand, mit der Lebensweise des Erwachens geschmückt sein.
(2) Mögen die körperlich und geistig Leidenden, die es in allen zehn Richtungen gibt, durch mein Verdienst Ozeane von Glück und Freude erlangen.
(3) Möge ihnen niemals das Glück schwinden, solange wie der Daseinskreislauf währt. Möge die Welt ununterbrochen die Freude von Bodhisattvas erlangen.
(4) Mögen die Höllenwesen, so viele es auch gibt in den Universen, sich dort an den Freuden von Sukhāvatī erfreuen.
(5) Mögen die von Kälte Geplagten Wärme erfahren, mögen die von Hitze Geplagten Kühlung erfahren durch die Meere von Wasser aus den großen Wolken, die die Bodhisattvas sind.
(6) Möge der Wald aus Schwertblättern für sie zum Glanz des göttlichen Waldes Nandana werden und die dornenbesetzten Marterpfähle zu wunscherfüllenden Bäumen.
(7) Mögen die Höllenbereiche freudvoll werden, verschönert durch Teiche und angefüllt mit den Rufen von Gänsen, Enten, Schwänen und anderem Getier und dem aufsteigendem Duft von Lotosblumen.
(8) Möge der Haufen glühender Kohlen eine Ansammlung von Edelsteinen werden und der glühende Fußboden ein Pflaster aus Kristall; mögen die zermalmenden Berge zu Palästen voll von Buddhas werden.
(9) Möge der Funkenregen von glühend heißen Steinen und Waffen von heute an ein Blumenregen sein, und möge das gegenseitige Bekämpfen mit Waffen von nun an ein spielerisches Gefecht mit Blumen sein.
(10) Mögen all jene, die im brennenden Wasser des [Höllenflusses] Vaitaraṇī versunken sind, deren Fleisch abgefallen ist und deren Knochen weiß wie Jasmin geworden sind, durch die Kraft meiner Verdienste einen göttlichen Körper erlangen und sich, begleitet von den Götterfrauen, am [himmlischen] Fluss Mandākinī aufhalten.
(11) Mögen die schrecklichen Helfer Yamas, die Krähen und Geier, sich erschrocken fragen: „Wessen Strahlen von Wohlsein und Freude könnten so leuchten, dass es die Dunkelheit überall vertreibt?“, und mögen sie, nachdem sie, nach oben schauend, den strahlenden Vajrapāṇi im Himmel erblickt haben, durch die Kraft der entstandenen Freude mit ihm vereint werden, befreit von allem Bösen.
(12) Möge ein Regen von Lotosblüten niederfallen, gemischt mit duftendem Wasser, so dass sie sehen, wie er zischend das Höllenfeuer löscht. Mögen die Höllenbewohner, plötzlich erquickt von Freude, Kamalapāṇi sehen.
(13) Kommt her, kommt her, legt ab die Furcht, ihr Brüder, wir leben! Wir haben ihn gefunden, den strahlenden, Furchtlosigkeit bringenden Jüngling mit dem Haarknoten, durch dessen Kraft alle Leiden verschwinden, die Macht der Liebe sich entfaltet, das Streben nach dem Erwachen und Mitgefühl, die Mutter des Schutzes aller Wesen, entsteht. 80
- Widmung
(14) Schaut ihn euch an, dessen Lotosfüße von den Kronen Hunderter von Göttern verehrt werden, dessen Augen von Mitgefühl feucht sind, auf dessen Haupt ein Regen von unzähligen Blumen fällt. Möge Mañjughoṣa vor den Augen der Höllenwesen erscheinen, und mögen ihre Schreie einstimmen in die von der Höhe der Häuser schallenden, schönen Gesänge von Tausenden von Götterfrauen, die wortgewandt sind in den Lobpreisungen.
(15) Mögen die Höllenwesen sich derart erfreuen, nachdem sie dank meiner heilsamen Handlungen die grenzenlosen Wolken von Bodhisattvas, allen voran Samantabhadra, gesehen haben, die den angenehmen und kühlen wohlriechenden Wind und Regen mit sich tragen.
(16) Mögen die großen Schmerzen und Ängste der Höllenwesen beseitigt werden; mögen alle, die sich in schlechten Umständen befinden, Befreiung von diesen finden.
(17) Möge die Angst der Tiere vor dem gegenseitigen Gefressenwerden vergehen; mögen die Hungergeister glücklich sein wie die Menschen des nördlichen Kontinents [Uttarakuru].
(18) Mögen die Hungergeister stets befriedigt, rein und ruhig sein durch die Milchströme, die von den Händen des Avalokiteśvara herabfließen.
(19) Mögen die Blinden Formen sehen, die Tauben stetig hören, und mögen die Schwangeren so schmerzlos gebären wie Māyādevī.
(20) Mögen sie Kleidung, Nahrung und Trank, Kränze, Sandelholz und Schmuck erhalten und all das, was dem Wohlsein dient, das sie sich wünschen.
(21) Mögen die Angstvollen frei sein von Angst, mögen die von Kummer Bedrückten Freude finden. Mögen die Rastlosen Ruhe finden und stabilen Geistes sein.
(22) Mögen die Kranken frei sein von Krankheit, die Gefesselten frei von allen Fesseln, und mögen die Schwachen stark sein und sich einander zugeneigt.
(23) Mögen alle Himmelsrichtungen für alle Reisenden günstig sein; möge der Zweck, den sie verfolgen, geschickt erfüllt werden.
(24) Mögen diejenigen, die sich auf eine Schiffsreise begeben, das Gewünschte erlangen und, nachdem sie auf angenehme Weise wieder am Ufer angelangt sind, sich mit den Verwandten freuen.
(25) Mögen diejenigen, die in der Wildnis ihren Weg verloren haben, auf Karawanen treffen, und mögen sie ohne Mühe gehen, frei von Gefahren durch Räuber, Tiger und so fort.
(26) Mögen die Götter die Schlafenden und die Trunkenen beschützen, die Unachtsamen und alle, die sich in Gefahr befinden, zu erkranken und sich zu verirren, die schutzlosen Kinder und die Alten.
(27) Mögen [die Wesen] befreit sein von allem Ungünstigen, mögen sie Vertrauen, Einsicht und Liebe haben, ein perfektes Aussehen und Verhalten und die Erinnerung an ihre vergangenen Leben.
(28) Möge der Reichtum unerschöpflich sein wie der Schatz des Himmelsraumes. Mögen alle ohne Streit und ohne Zwang selbstbestimmt handeln können.
81
- Widmung
(29) Mögen die Wesen mit geringem Charisma sehr charismatisch werden; mögen die Elenden, die hässlich sind, vollkommene Körper haben.
(30) Mögen alle weiblichen Wesen der Welt zu männlichen werden; mögen die Niederen hohe Ränge erlangen und dabei frei sein von Stolz.
(31) Mögen durch dieses mein Verdienst ausnahmslos alle Wesen vom Unheilsamen ablassen und stets Heilsames tun,
(32) nicht getrennt sein vom Streben nach dem Erwachen, dem Verhalten des Erwachens verpflichtet und ganz von den Buddhas angenommen, frei von den Handlungen Māras.
(33) Mögen all die Wesen ein unermessliches Leben haben, immer glücklich sein, und möge selbst das Wort „Tod“ verschwinden.
(34) Mögen alle Himmelsrichtungen, angefüllt mit Buddhas und Bodhisattvas, geschmückt sein mit Hainen von wunscherfüllenden Bäumen, die das Herz erfreuen durch den Klang des Dharma.
(35) Möge die Erde eben sein, frei von scharfen Kieseln und weich wie die Handfläche, möge der Boden überall aus Beryll bestehen.
(36) Mögen sich überall Kreise großer Gruppen von Bodhisattvas niederlassen, und mögen sie die Welt mit ihrem eigenen Glanz verschönern.
(37) Möge der Klang der Lehre, verbreitet von Vögeln, von allen Bäumen, Sonnenstrahlen und sogar dem Himmel, von allen Wesen ununterbrochen gehört werden.
(38) Mögen sie stets mit den Buddhas und Bodhisattvas zusammentreffen, und mögen sie mit Wolken von Opferungen den Lehrer der Welt verehren.
(39) Möge der [Regen-]Gott es rechtzeitig regnen lassen, und möge die Ernte reich sein, möge die Welt gedeihen und der Herrscher rechtschaffend sein.
(40) Mögen die Arzneien wirkungsvoll sein, die Mantras der Rezitierenden erfolgreich; mögen die Dākiṇīs und Dämonen von Mitgefühl erfüllt sein.
(41) Möge kein Wesen leiden, mit unheilsamen Handlungen behaftet oder krank, gering, erniedrigt oder unzufrieden sein.
(42) Mögen die Klöster, angefüllt von Studium und Übung, wohlerhalten sein; möge der Sa‡gha stets in Harmonie sein, und mögen die Ziele des Sa‡gha erfüllt werden.
(43) Mögen die Mönche, die zu üben wünschen, einsame Plätze finden; mögen sie mit wachem Geiste meditieren, frei von aller Ablenkung.
(44) Mögen die Nonnen gut versorgt sein, frei von Streit und Anstrengung, und mögen ebenso alle wandernden Asketen von ungebrochener Diszplin sein.
(45) Mögen die von schlechter Disziplin dies bereuen und sich stets bemühen, unheilsame Handlungen zu verringern; mögen sie gute Daseinsbereiche erlangen und auch dort ihre Gelübde nicht brechen.
(46) Mögen die Gelehrten verehrt werden und Almosen erhalten; möge ihr Geistesstrom rein sein und ihr Ruhm in allen Himmelsrichtungen bekannt.
(47) Mögen die Wesen der Welt, ohne das Leiden schlechter Daseinsbereiche erfahren zu haben und ohne harte asketische Praxis, mit einem göttlichen Körper die Buddhaschaft erlangen.
(48) Mögen all die vollendeten Buddhas von all den vielen Wesen verehrt werden. Mögen sie erfreut sein durch die vielen unvorstellbaren Buddhafreuden.
(49) Mögen die Wünsche der Bodhisattvas zum Wohle der Wesen in Erfüllung gehen; möge das, was diese Beschützer anstreben, für die Wesen erlangt werden.
(50) Mögen die Pratyekabuddhas und ebenso die Śrāvakas glücklich sein, und mögen sie mit Hochachtung von Göttern, Halbgöttern und Menschen ständig verehrt werden.
(51) Möge ich durch die Fürsorge Mañjughoṣas immer die Fähigkeit erlangen, mich meiner früheren Leben zu erinnern und als Mönch leben, bis ich die erste Bodhisattva-Ebene „Große Freude“ erreiche.
(52) Möge ich stark sein, wo auch immer ich mich aufhalte; möge ich in allen Wiedergeburten vortreffliche Orte in der Abgeschiedenheit erlangen.
(53) Möge ich, wann auch immer ich ihn zu sehen wünsche, selbst wenn ich nur etwas Geringes zu fragen wünsche, den Beschützer Mañjunātha ungehindert sehen.
(54) Möge mein Verhalten wie das des Mañjūśrī sein, der zum Erfüllen der Absichten aller Wesen der zehn Richtungen aktiv ist.
(55) Solange der Himmelsraum besteht und solange die Welt besteht, solange möge auch ich bestehen, um die Leiden der Wesen zu beseitigen.
(56) Welches Leiden auch immer in der Welt besteht, möge es in mir zur Reife kommen, und möge die Welt durch das Heilsame der Bodhisattvas glücklich sein.
(57) Möge die Lehre [des Buddhas], die einzige Medizin für die Leiden der Welt, der Ursprung allen Reichtums und Glücks, hochgeschätzt und verehrt werden und lange bestehen.
(58) Ich verneige mich vor Mañjughoṣa, durch dessen Güte mein Geist sich auf das Heilsame richtet, und ich verneige mich vor dem geistigen Freund, durch dessen Güte es gedeiht.
(Kolophon) Damit ist das von Ācārya Śāntideva verfasste Werk „Anleitung auf dem Weg zum Erwachen“ beendet. Es wurde [aus dem Sanskrit in das Tibetische] übersetzt vom indischen Gelehrten Sarvajñādeva und dem [tibetischen] Editor und Übersetzer-Mönch Paltseg (dPal-brtsegs), nachdem sie den [Sanskrit-Text] zuvor nach einer Kashmir-Edition ediert und festgelegt haben. Dann wurde er erneut von dem indischen Gelehrten Dharmaśrībhadra und den Editoren und Übersetzer-Mönchen Rinchen Sangpo (Rin-chen-bzang-po) und Śākya Lodrö (Śā-kya-blo-gros) in Übereinstimmung mit einer Edition und einem Kommentar aus Magadha überarbeitet, übersetzt und herausgegeben. Zu späterer Zeit wurde er noch einmal von dem indischen Gelehrten Sumatikīrti und dem Editor und Übersetzer Gelong Loden Sherab (bLo-ldan-shes-rab) korrigiert, übersetzt und [in der vorliegenden Fassung] herausgegeben.
Fußnoten
-
Vesna A. Wallace und B. Alan Wallace haben in ihrer Übersetzung aus dem Sanskrit diese Stellen dokumentiert und zusätzlich aus dem Tibetischen übersetzt. ↩︎
-
Schmidt, Richard: Der Eintritt in den Wandel in Erleuchtung. Ein buddhistisches Lehrgedicht des VII. Jahrhunderts n. Chr.. Paderborn: Schöningh, 1923. (Eine Neuausgabe ist frei elektronisch verfügbar unter www.angkor-verlag.de: Shântideva: Anleitung zum Leben als Bodhisattva [Bodhicaryâvatâra]. Aus dem Sanskrit von Richard Schmidt. Frankfurt: Angkor Verlag, 2012. ↩︎
-
Śāntideva: Eintritt in das Leben zur Erleuchtung. Lehrgedicht des Mahāyāna. Aus dem Sanskrit übersetzt von Ernst Steinkellner. Düsseldorf, Köln: Diederichs Verlag, 1981 (Neuauflage 1997) ↩︎
-
Crosby, Kate / Skilton, Andrew: Śāntideva. The Bodhicaryāvatāra. New York: Oxford Universitiy Press, 1996 ↩︎
-
Śāntideva: A Guide to the Bodhisattva Way of Life. Translated from the Sanskrit and Tibetan by Vesna A. Wallace and B. Alan Wallace. Ithaca: Snow Lion Publications, 1997 ↩︎
-
Bodhisattvacaryāvatāra, Byang chub sems dpa’i spyod pa la ’jug pa. Derge Tengyur La 1b-40a (Tohoku 3871) dKyil-zur Yong-’dzin Blo-bzang-sbyin-pa: Byang chub sems dpa’i spyod pa la ’jug pa’i don rnam par bshad pa rGyal sras ’jug ngogs kyi snying po, in Collected Works, Delhi: Chophel Legden, 1979. TBRC W22949, p. 135 ↩︎
-
dKyil-zur Yong-’dzin Blo-bzang-sbyin-pa: Byang chub sems dpa’i spyod pa la ’jug pa’i don rnam par bshad pa rGyal sras ’jug ngogs kyi snying po, in Collected Works, Delhi: Chophel Legden, 1979. TBRC W22949, p. 135 ↩︎
-
(Mi-nyag Kun-bzang-bsod-nams) Thub-bstan-chos-kyi-grags-pa: Byang chub sems pa’i spyod pa la ’jug pa’i ’grel bshad rgyal sras rgya mtsho’i yon tan rin po che mi zad ’jo ba’i bum bzang. Krung go’i bod kyi shes rin dpe skrung khang, 1988 ↩︎
-
rGyal-tshab Dar-ma-rin-chen: sPyod ’jug rnam bshad rgyal sras ’jug ngogs. Sarnath: The Pleasure of Elegant Sayings Printing Press, 1973 ↩︎
-
Allerdings ist auch die Übersetzung „Erleuchtung“ nicht abwegig. Häufig wird das Gegensatzpaar von Licht und Dunkelheit als Metapher für Erkenntnis und Unwissenheit benutzt, und die wesentliche Qualität des Erwachens ist Erkenntnis. Eine umfassende Forschungsarbeit über die Idee von bodhicitta ist Wangchuk, Dorji: The Resolve to Become a Buddha. A Study of the Bodhicitta Concept in Indo-Tibetan Buddhism. The International Institute for Buddhist Studies, Tokyo, 2007. Zur Übersetzung von bodhicitta s. S. 69 f. ↩︎
-
Skt. nātha, Tib. thub pa, ein Beiname des Buddha. ↩︎
-
Entsprechend Prajñākaramatis Kommentar legt der Sanskrit-Text eine andere Übersetzung des zweiten Teils dieses Verses nahe (Steinkellner 1981): „Denn Unheilsames gegen die Buddhasöhne ist nur unter großer Anstrengung möglich, mühelos dagegen das Gute.“
Die tibetische Übersetzung fügt eine Negationspartikel hinzu (sdig pa mi ’byung). Zudem kann die tibetische Übersetzung do gal für „Anstrengung“ (Skt. bala) auch „schwerwiegender Umstand“ bedeuten. Somit geht es nach üblicher tibetischer Interpretation dieses Verses nicht um die große Kraft oder Überwindung, die ein Übelgesinnter aufbringen muss, um einem Bodhisattva tatsächlich zu schaden, sondern um widrige Umstände, auf die ein Bodhisattva auf seinem Weg trifft, die ihn aber nicht zu einer Übertretung seiner eigenen ethischen Prinzipien verleiten, vielmehr werden sie seine altruistische Haltung noch weiter stärken. Die tibetischen Kommentatoren interpretieren dabei die Lokativ-Endung des Wortes Bodhisattva so, dass Unheilsames nur schwer (bwz. nach tibetischer Übersetzung gar nicht) bei dem Bodhisattvas selbst entstehen kann und nicht, wie nach dem Sanskrit-Kommentar, gegenüber dem Bodhisattva bei der Person, die dem Bodhisattva übel gesonnen ist.
Der Kommentar von Minyak Kunzang Sönam nennt aber auch die alternative Interpretation entsprechend dem Sanskrit-Kommentar (Minyak S. 59 f ). Danach könnte man das Tibetische auch so übersetzen: „Denn selbst mit großer Anstrengung vermag man gegenüber den Bodhisattvas nichts Böses zu tun; stattdessen wächst das Heilsame unwillkürlich an.“ ↩︎ -
Ajita, mit anderem Namen Maitreya, wird nur im Sanskrit-Original als weiterer Bodhisattva genannt. ↩︎
-
In der Sanskrit-Fassung findet sich vor diesem ein zusätzlicher Vers, der in der tibetischen Übersetzung nicht enthalten ist. Er gilt laut Steinkellner allgemein als interpoliert und wurde in seine deutsche Übersetzung auch nicht aufgenommen. Steinkellners Übersetzung überspringt in der Zählung die Versnummer 32, daher weichen die Verszählungen ab hier um einen Schritt voneinander ab. ↩︎
-
Dieser Vers ist in der tibetischen Übersetzung länger als im Sanskrit-Original. ↩︎
-
Im Sanskrit-Original wechselt das Subjekt der Kontemplation häufig zwischen der ersten und der dritten Person. Dieses ergibt sich im Sanskrit aus der Beugung des Verbs. Im Tibetischen wird das Verb allerdings nicht nach der grammatischen Person des Subjekts gebeugt. Ebenso gibt es im Tibetischen keine Unterscheidung zwischen dem Optativ („wollen / sollen“) und dem Futur („werden“) wie im Sanskrit.
Die jeweils letzte Zeile dieser Verse (de tshe shing bzhin gnas par bya) kann daher im Tibetischen bedeuten: „will / werde ich“ oder „soll / wird er wie Holz verharren.“ Die Übersetzung folgt hier dem Sanskrit. Śāntideva scheint relativ willkürlich die Person des Subjekts zu wechseln, da es sich bei den ethischen Forderungen gleichzeitig um eine allgemeine Anweisung („soll er“, „soll man“) als auch eine ethische Ermahnung oder einen Vorsatz für sich selbst („soll / will / werde ich“) handelt. In anderen Fällen ist der Text so verfasst, dass der Autor (der aus der Perspektive des kontemplierenden Lesers schreibt) sich im Imperativ an sich selbst richtet (wie etwa in Vers 4.47 „Lass ab von deiner Furcht, mein Herz, bemühe dich um Einsicht!“) ↩︎ -
Der vorliegende tibetische Text legt die Übersetzung nahe: „Wenn ihn (den Körper) einst die Geier … hin- und her zerren werden, dann wirst du, mein Geist, dich nicht dagegen auflehnen. Warum verherrlichst du ihn jetzt?“ (yid khyod mi dgar mi byed na | da lta ci phyir kha ta byed). Die deutsche Übersetzung folgt hier aber dem SanskritText, nach dem es der (tote) Körper ist, der nichts zu seinem Schutz gegen die Geier unternehmen kann. Der Kommentar von Minyak Kunzang Sönam erwähnt auch diese Variante (lus khyod mi dgar mi byed na … ). Die Idee ist bei beiden Varianten, dass die übermäßige Identifikation mit dem Körper und das begehrliche Hängen daran schon zu Lebzeiten ungerechtfertigt ist, wenn der Körper sich nicht einmal um sich selbst sorgen kann und schließlich in jedem Fall aufgegeben werden muss. ↩︎
-
Der tibetische Kommentar von Minyak Kunzang Sönam erklärt dazu: Lobt man jemanden öffentlich, könnte leicht der Eindruck entstehen, es handle sich um bloße Schmeichelei. Schließt man sich einem öffentlich ausgesprochenen Lob aber nicht an, könnte das Gegenüber denken, man hätte Missfallen daran. ↩︎
-
Im Sanskrit: „Jenen Mitleidsvollen, die den Nutzen vorhersehen, sind sogar Handlungen erlaubt, die sonst untersagt sind.“ ↩︎
-
„Die Drei Anhäufungen“ sind nach Prajñākaramati, „zusammengefasst das Bekennen negativer Handlungen, das Erfreuen an verdienstvollen Handlungen und die Widmung [alles Heilsamen] für das Erwachen.“ Ebenso bezieht sich der Ausdruck auf das Mahāyāna-Sūtra mit dem gleichen Titel (Triskandhaka, Phung po gsum pa DK 284, mDo sde Ya 57a.3-77a.3). ↩︎
-
Der Sanskrit-Text besagt, dass man aus dem Ākāśagarbhasūtra die Hauptregeln des Bodhisattva-Gelübdes entnehmen soll. ↩︎
-
Der Śikṣāsamuccaya ist ein weiterer Text von Śāntideva. ↩︎
-
Alternative Variante im tibetischen Text: „… die von dem erhabenen Nāgārjuna verfassten zwei [Werke gleichen Namens]“. Nach dieser Lesart habe Nāgārjuna ebenso wie Śāntideva ein Werk mit dem Titel „Kompendium der Übungsregeln“ (Śikṣāsamuccaya) verfasst, das allerdings nicht Eingang in den tibetischen Kanon der übersetzten Kommentarliteratur gefunden habe. In jeder Lesart ist als zweites Werk das von Nāgārjuna verfasste „Kompendium der Sūtras“ gemeint. ↩︎
-
Der Zusatz „einen einzigen“ findet sich nur in der tibetischen Ausgabe. Nach dem Sanskrit: „… wird durch Wut wieder zunicht gemacht.“. ↩︎
-
Nämlich von den Fehlern, die der Kritiker wahrnimmt und dadurch zu der Kritik veranlasst wird. ↩︎
-
Nämlich dann, wenn diese anderen, mit denen sie sich freuen und die sie loben, meine Gegner sind, denen ich das Lob nicht gönne. ↩︎
-
Die Welt unter, auf und über der Erde; also das ganze Universum. ↩︎
-
Der Sanskrit-Text lautet (in der Übersetzung von Schmidt): „Wenn der Tod seine Vorbereitungen getroffen hat, wird er schnell kommen.“ Der Kommentar von Minyak weist auch auf diese Variante hin. ↩︎
-
Nach dem Sanskrit-Text: „… wenn dir, zartes Kind, doch schon [hier] die Schmerzen durch die Berührung mit heißem Wasser zusetzen?“ ↩︎
-
Sanskrit: „… solange ich den Vorschriften des Allwissenden folge.” ↩︎
-
Die „Hörer“ (śrāvaka) streben, anders als der Bodhisattva, der zum Wohle aller Wesen das vollkommene Erwachen eines Buddhas erreichen will, die persönliche Befreiung aus dem Daseinskreislauf als Hauptziel an. Der Sanskrit-Text lautet: „Aus diesem Grund schreitet er schneller voran als selbst die Hörer.“ ↩︎
-
Im Sanskrit chanda (häufig als „Verlangen nach dem Guten“ übersetzt). Als deutsche Übersetzung habe ich „Anstreben“ gewählt. Die tibetische Übersetzung von chanda ist gewöhnlich ’dun pa. Sie findet man in der Darstellung der Geistesfaktoren der indischen Abhidharma-Tradition: Nach Asa‡ga gehört chanda (Tib. ’dun pa) zu einer Gruppe von fünf Geistesfaktoren, die zu einer intensiveren Beschäftigung mit einem (heilsamen) Bewusstseinsobjekt führen.
Die tibetische Übersetzung des Bodhicāryavatāra verwendet hier jedoch mos pa (gewöhnlich die Übersetzung von Skt. adhimokṣa), was man als „gläubiges Vertrauen“, „innere Überzeugung“ oder „Wertschätzung“ übersetzen kann. Dies ist ein anderer Geistesfaktor in derselben Gruppe. Ich habe hier nach dem Sanskrit übersetzt. Auch der tibetische Kommentar von Minyak Kunzang Sönam weist darauf hin, dass hier ’dun pa gemeint ist. ↩︎ -
Nach Minyak werden in einem Kommentar von Vibhūti Zweifel an der Echtheit dieses Verses geäußert, da die Zusammenfassung der Kräfte für die Entwicklung der Tatkraft an dieser Stelle redundant erscheint; denn die hier genannten vier Kräfte werden im nächsten Vers 32 wiederholt (wobei die Kraft der Festigkeit dort als „Selbstbewusstsein“ bezeichnet wird) und mit weiteren Gegenmitteln gegen die Trägheit vervollständigt. Somit gilt Vers 32 als die eigentliche Zusammenfassung der Kräfte zur Entwicklung der Tatkraft. ↩︎
-
Dasselbe Wort „Stolz“ (Skt. māna, Tib. nga rgyal) wird hier einerseits für ein positives Selbstbewusstsein im Sinne von Selbstvertrauen, innerer Stärke, Beharrlichkeit und fester Entschlossenheit, andererseits für verblendeten Stolz im Sinne von Hochmut, Überheblichkeit und Anmaßung verwendet. Die jeweilige Bedeutungsvariante ergibt sich nur aus dem Zusammenhang. In der deutschen Übersetzung wird versucht, die Doppeldeutigkeit zu vermeiden, allerdings gehen dabei die Wortspiele des Autors verloren. Der Leser mag daher versuchsweise in den nächsten Versen „Selbstbewusstsein“ gegen „Stolz“ austauschen (bzw. „selbstbewusst“ gegen „stolz“ etc.). ↩︎
-
Dieser sechszeilige Vers im tibetischen Text findet sich nicht im Sanskrit-Text. ↩︎
-
Hier gibt es zwei Lesarten des Sanskrit, auf die der Kommentar Prajñākaramatis hinweist: „dass die Leidenschaften von jenem Menschen vernichtet werden, der durch Geistige Ruhe mit meditativer Einsicht wohl versehen ist“ (vgl. Steinkellner) oder „dass die Leidenschaften durch die meditative Einsicht, welche mit geistiger Ruhe wohl versehen ist, vernichtet werden“.
Im ersten Fall ist die geistige Ruhe (śamatha) als Ursache für die Einsicht (vipaśyanā) zu verstehen, so dass dann mit einer solchen Einsichtsmeditation die Leidenschaften überwunden werden. Im zweiten Fall wird gesagt, dass durch die Verbindung der Einsicht mit der meditativen Ruhe des Geistes die Leidenschaften überwunden werden. Im Endeffekt läuft es aber nach beiden Interpretation auf eine Einheit von beiden hinaus, wie auch der Kommentar von Prajñākaramati feststellt. ↩︎ -
Aus dem Sanskrit lässt sich diese Stelle auch anders interpretieren: „Die [Geistige Ruhe] entsteht durch die Loslösung von der Freude an der Welt.“ (vgl. Steinkellner) ↩︎
-
Dieser Vers findet sich nicht im Sanskrit-Text. ↩︎
-
In den Versen 121‒124 steht im Tibetischen „Körper“ (lus) statt „Selbst“ (Skt. ātman, Tib. bdag). Der Begriff „Körper“ steht hier eher für die Gesamtheit dessen, womit wir uns als Selbst identifizieren. Man findet allerdings im Sanskrit nicht selten das Wort ātman auch mit der Bedeutung „Körper“. ↩︎
-
Sie akzeptieren also die Konventionen als Mittel auf dem Weg zum Erwachen, auch wenn sie um ihre nur vordergründige, gewissermaßen „unwirkliche“ Wirklichkeit wissen. So üben sie etwa die Freigebigkeit und andere Tugenden, ohne sie kritisch zu hinterfragen im Hinblick darauf, ob sie endgültige Wirklichkeit besitzen. ↩︎
-
Die Verse 49‒51 werden von Prajñākaramati als Hinzufügung bezeichnet, weil sie an dieser Stelle nicht zum Thema gehörten und weil sie sich geringschätzig über die großen Schüler des Buddhas äußerten. Entsprechend sind diese Verse in der deutschen Übersetzung von Steinkellner ausgelassen worden. ↩︎